Dies ist mein Engelimbiss. Hier schreibe ich von Gott und der Welt. Halbfertiges und Angedachtes, je nachdem.
Den "Engelimbiss" gibt es wirklich. Dort, wo Hamburg Richtung Nordsee zeigt, gibt es die besten Pommes mit allerschönstem Elbblick. Ich finde, Texte für die Seele sollen genauso schmecken: wie gute Pommes.
Wo Gott wohnt (wenn Sommer ist)

Ich glaube, du hast eine Höhle im Wald
irgendwo im Unterholz
dort lebst du mit Ameisen und Feuerwanzen
die versuchen dich nicht einzusperren
und sind gesellig
Größe spielt keine Rolle
- soweit ich weiß -
Manchmal kommt eine Spitzmaus vorbei
Ich glaube
selbst Menschen
sind willkommen
Lustprinzip
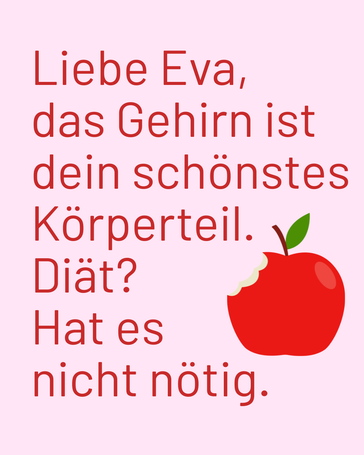
Liebe Eva,
ich bin Susanne. Ich mag Himbeeren und Gendersternchen und dich. Wenn ich an dich denke, denke ich an Emanzipation. Das Wort hast du erfunden. Ich seh dich, wie du auf der Schwelle stehst. Nach
draußen, ins Freie. Die Sicherheit lässt du zurück. Aber hej, denke ich - fürchte dich nicht. Gott hat die Sehnsucht in unser Herz gelegt. Nicht die Schuld. Lass dir das nicht einreden, auch in
hunderttausend Jahren nicht. Männer haben das lang genug versucht, um die Welt zu beherrschen und die Frauen dazu. Hier ist dein Platz, haben sie gesagt und die Mauern immer enger gezogen, bis
das Paradies nur noch vom Herd bis zur Wiege reichte.
Wenn es gut läuft, wirst du als Mutter aller Menschen bezeichnet, das ist auch so ein Ding: Wenn schon Frau, dann wenigstens Mutter. Okay, dann sage ich es mal so: Du hast uns die Lust am Denken
in die Wiege gelegt. Die Lust, zu fragen: Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum – wer nicht fragt, bleibt dumm.
Das Gehirn ist dein schönstes Körperteil. Diät? Hat es nicht nötig.
Es gebiert die Phantasie, die vorwegnimmt, was noch nicht ist, aber sein könnte. Und dazu haben wir ein funktionsfähiges Gewissen bekommen und ein Herz voll Empathie. Du bist nicht die einzige auf der Welt. Adam steht an deiner Seite, und das ist gut. Besser ist es zu zweit und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Ich bin eure Verbündete, und ich hab Lust. Weiterzudenken. Ich hab Lust, die Welt zu erforschen. Es gibt so viel zu entdecken. Amen, sagt Gott. Und gibt uns Proviant für unterwegs: Drei Äpfel und einen Sack Vertrauen.
aus: Drei Briefe an Eva. Wohnzimmerkirche, Lustprinzip
Mai!

Ich war mal Maikönigin. Also nicht offiziell, nicht mit Schärpe und Presse und Trallala. Es war einer dieser Tanz-in-den-Mai-Feiern, die man damals noch Feten nannte, und wir waren ziemlich unter uns. Irgendwo in der Nähe von Steinhude, falls euch das was sagt. Mein Ruhm währte kurz, ich nehme an, von Mitternacht bis zum Morgengrauen, was aber überhaupt nichts machte. Schließlich erinnere ich bis heute daran, wie das ist: Einmal Königin sein. Nicht, weil ich die Schönste war (war ich nicht). Nicht, weil ich am besten tanzen konnte (konnte ich nicht). Nicht, weil mein Vater bereits König war (eher Bauer). Ich hatte zufällig am überzeugendsten ein paar Scherzfragen beantwortet. Keine große Sache. Was ich sagen will, ist: wie gut sich das anfühlt, für einen Moment zu glänzen. Bejubelt zu werden, ganz ohne Grund. Kurz genug, damit es nicht zu Kopf steigt. Lang genug für das
Gefühl: Du bist wer. Du zählst. Sagt Gott, immer wieder, lebenslang. Sollten wir so oft es geht weitersagen. Zum Beispiel heute Nacht: Setzt doch mal jemandem eine Krone auf. Und tanzt, schwebt, stolpert, lauft zusammen in den Mai.
Als Frau Meckelbach aufersteht

Als Frau Meckelbach aufersteht, blühen die Narzissen. Im Grab ist es zu eng. Frau Meckelbach, litt Zeit ihres Lebens an einer leichten Form von Platzangst. Sie verlässt den Sarg und staunt, wie das möglich ist. Schließlich hat Egon massive Eiche gewählt, das, fand er, war er seiner Gattin schuldig. Und dann liegt ja auch noch eine Tonne Erde über ihr, ein unter normalen Umständen beängstigender Gedanke. Aber normal ist nichts mehr. Frau Meckelbach gleitet hinaus, ins Freie, ihren Körper lässt sie zurück. Ein kurzes Bedauern flammt in ihr auf, denn schließlich waren sie lange miteinander unterwegs gewesen. Andererseits gehörte Frau Meckelbach nie zu denen, die jedes Kleid aufheben müssen, weil es ja sein könnte, dass man es noch mal tragen würde. Nach einer Diät. Oder wenn die Mode wechselt. Frau Meckelbach braucht ihren Körper nicht mehr. Frau Meckel wird nie wieder Diät machen, sie atmet auf. Atmen funktioniert überraschenderweise. In ihrem Inneren ist ein so ungeheurer Drang nach Luft. Frühlingsluft. Sie saugt sie in sich ein, dass sie zu schweben beginnt, hinauf, hinauf, bis an die Grenzen der Vorstellungskraft. Und darüber hinaus.
Sturm. Wutbürgerinnen und Moralapostel

Morgens um halb zehn geht das Volk auf die Straße. Morgens um halb zehn sieht Herr Müller rot. Herr Müller ist wütend und brüllt. Zusammen mit den anderen. Hat einen Galgen gebaut, hat Bilder von Politikern drangehängt. Herr Müller ist enttäuscht, fühlt sich verraten und verkauft. Sein Gesicht ist hassverzerrt. Dabei ist er sonst ganz lieb und geht sonntags mit den Kindern in den Zoo. Herr Müller kann tausend Namen haben, Hans-Martin oder Kevin. Bill oder Claudia oder Salim.
Herr Müller lebt überall auf der Welt. Herr Müller ist tausend mal tausend Jahre alt. Herr Müller war auch damals dabei, an jenem Freitag und hat Jesus durch die Straßen getrieben, hat geschrien: „Tötet ihn! Tötet ihn!“ Damals hieß Herr Müller vielleicht Hanna oder Thomas. Herr Müller kannte Jesus nicht persönlich. Anfangs fand er ihn ganz gut. Weil der gesagt hat: „Ich ändere was. Echt. Himmel auf Erden, die Letzten werden die Ersten sein!“
In Herrn Müller war so eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, wobei er das nie so formuliert hätte. Aber dass etwas falsch läuft, das war eindeutig. Damals und heute und immer wieder: Die Reichen sind zu reich und die Armen zu arm. Die Mächtigen sind zu mächtig, und einer wie Herr Müller ist zu ohnmächtig. Und diese Ohnmacht, die macht ihn rasend. Und deshalb hat er zugehört, als Jesus redete. Hat an seinen Lippen gehangen und gesehen, wie 5000 Leute mucksmäuschenstill waren und satt wurden. Leute wie er. Ganz normale Leute.
Und jetzt läuft Herr Müller durch die Straßen und schreit. Wie konnte es bloß soweit kommen?
2000 Jahre und einen Tag zurück. Donnerstagmorgen:
Judas hat sich entschieden. Irgendwer muss handeln. Immer nur reden, reden, reden. Das führt zu nichts. Judas ist kein Hitzkopf und auch kein böser Mensch. Aber in seinem Bauch brodelt es. Judas
lebt in einem besetzten Land. Steuern und Zölle sind hoch. Die Korruption blüht. Immer wieder gibt es Aufstände, die brutal niedergeschlagen werden. Propheten versprechen ein neues
Zeitalter.
Einer dieser Propheten ist Jesus. Ihm hat Judas sich angeschlossen. Und jetzt ist er enttäuscht, genau wie Herr Müller. „Jesus?“, würde er sagen, wenn wir ihn fragen könnten. „Ist genau wie alle
anderen. Nichts als leere Versprechen.“ Dabei hatte er von ganzem Herzen an ihn geglaubt. Dass eine andere Welt möglich sei. Judas wollte den Umsturz der Verhältnisse. Wollte die Besatzer zum
Teufel jagen. Wollte, dass etwas ganz Großes passiert. Etwas, das alles ändert.
Jetzt ist Schluss. Jetzt nimmt er die Sache selbst in die Hand. Judas verrät, wo Jesus sich aufhalten wird in dieser Nacht. Verrät, wo sie essen werden, verrät, was er liebt. Kassiert ein
Säckchen Silber dafür (aber es geht ihm nicht ums Geld). Judas verrät Jesus und setzt auf Eskalation. Damit Jesus zeigen kann, wer er wirklich ist. Damit der Sturm losbricht.
Donnerstagabend:
Die Kerzen brennen noch. Noch schimmert der Wein im Glas. Noch sind sie alle zusammen. Da sagt Jesus: „In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern über mich.“ Werdet euch abwenden, irre werden,
werdet verletzt sein, beleidigt. Als sie das hören, bleibt ihnen der letzte Bissen im Hals stecken. „Ich niemals!“, ruft Petrus und braust wie immer ein bisschen auf. Aber Jesus redet einfach
weiter: „Die Menschen werden euch hassen, weil sie mich hassen.“ Die Worte stehen wie Gewitter im Raum. Aber noch entlädt sich nichts. Wieso Hass?, denkt Petrus. Woher kommt dieser Hass?
Alle schlafen. Obwohl man jetzt wach sein müsste. Der Sturm zieht auf. Seit Tagen schon. Wer Ohren hat, der höre. Zusammen könnte man das Schlimmste verhindern. Aber so schlimm wird es schon
nicht werden, oder? Es wird schon gut gehen. Ist bisher immer gut gegangen. Alle schlafen, Jesus betet. Allein. Beten ist Protest, der zum Himmel schreit. „Wacht auf!“, möchte man den anderen
zurufen. „So wacht doch auf, ihr Narren! Habt ihr schon vergessen, was mit Johannes dem Täufer passiert ist? Habt ihr vergessen, wie sie seinen Kopf auf einem Tablett präsentiert haben? Das ist
kein Einzelfall.“
Mitternacht:
Sie kommen. Sie kommen, ihn zu holen. Mit Schwertern und mit Stangen kommen sie. Petrus will kämpfen. „Was auch immer geschieht, ich halte zu dir“, hatte er versprochen. Jetzt ein Held sein, er
zieht die Klinge und sticht zu – aber Jesus greift ihm ins Messer. „Lass gut sein“, sagt er. „Steck die Waffe weg. Du wirst wen verletzen.“ Und dann sagt er noch: „Wer zur Waffe greift, wird
durch die Waffe umkommen.“ Sie führen Jesus ab, und er geht mit, widerstandlos. Warum?, will Petrus schreien. Warum?, will Judas schreien. Wo ist das Wunder, das du versprochen hast?
Freitag in aller Frühe:
Der römische Statthalter Pilatus verspeist ein Hühnerbein, als sie ihm den Angeklagten bringen: Störung der öffentlichen Ordnung. Aufwiegelung und Amtsanmaßung. Darauf steht die Todesstrafe.
Aufwiegler werden gekreuzigt. Das schreckt ab. Pilatus will die Sache schnell erledigen. Hauptsache kein Aufruhr. Denn Pilatus will Karriere machen. Der Rest ist ihm herzlich egal.
Pilatus mustert diesen Jesus. Er könnte ihn retten. Das wär mal was. Irgendwas imponiert ihm an dem. Stellt sich hin und sagt: Ich bin König. Drollig irgendwie. Tut keinem was zu leide. Das
bringt die Leute zur Raserei. Von draußen ist das Gebrüll zu hören. Pilatus befiehlt, die Fenster zu schließen. Er findet Kreuzigungen barbarisch. Etwas für den Pöbel.
Mit diesem Jesus könnte man sich vielleicht unterhalten. Er hält ihm ein Hühnerbein hin. Keine Reaktion. Schade. Wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, soll dieser Jesus dem Genuss nicht
abgeneigt sein. Und dabei als Redner talentiert. Etwas Abwechslung. Pilatus wischt sich die Finger an der Serviette ab und rülpst dezent. Die Schreie draußen werden lauter. Nützt ja nichts, denkt
er und geht hinaus.
Freitag, kurz nach Sonnenaufgang:
Pilatus tritt vor die Menge. Eine anonyme Masse. Er hat aufgehört, in Gesichter zu sehen. Für ihn sehen sie alle gleich aus. Ihre Wut und ihr Hass schlagen ihm entgegen wie ein Feuersturm.
Pilatus kann das nicht nachvollziehen. Einer wie er braucht keine Wut. Er setzt ein gütiges Gesicht auf und bietet ihnen Gnade an. Großherzige Gnade: „Den da“, sagt er und zeigt auf Jesus, „oder
Barrabas. Wen soll ich laufen lassen?“ Jesus, den Rebellen, der an den Himmel glaubt, oder Barrabas, den verurteilten Verbrecher. Einen, der nicht mal Worte als Waffe benutzt, oder einen Mörder.
„Barrabas!“, rufen sie. Immer wieder: „Barrabas!“ Sterben soll der andere. „Was hat er getan?“, fragt Pilatus. Aber seine Frage geht unter im Geschrei des Mobs: „Kreuzigt ihn! Kreuzigt ihn!“
Barbaren, denkt Pilatus und geht hinein, um sich die Hände zu waschen.
Freitag, gegen Mittag:
Die Soldaten hämmern Nägel ins Kreuz. Mitten durch die Handgelenke, später auch durch die Fußgelenke. Sie können das gut, ihre Schläge sind schnell und kräftig. Die Schreie könnten Tote
aufwecken, aber sie hören sie nicht mehr. Der da ist nur noch ein Bündel Fleisch. Da, wo das Gesicht war, ist Blut. Die Folter gehört zur Strafe.
Sie haben getrunken, vielleicht sind auch Drogen im Spiel, das nimmt niemand so genau. Irgendwer muss die Drecksarbeit machen. Sie tun nur ihre Pflicht, und irgendwas wird schon dran sein.
Unschuldig sind die doch alle nicht. Außerdem gibt es Zulagen, sie spielen um die Kleider der Verurteilten, weil wer da oben hängt, der braucht nichts mehr zum Anziehen – die Blutflecken
kriegst du eh nicht mehr raus – haha! Wer die härtesten Witze macht, kriegt einen Schnaps.
Freitagnachmittag:
Jesus hängt am Kreuz. Die Menge hat sich zerstreut, der Sturm ist gestillt. Jetzt kommt nichts mehr, außer dem Tod. Die Frauen bleiben. Können nichts tun, aber bleiben. Die Frauen haben auch
Namen, das vergisst man schnell. Dreimal Maria: Seine Mutter. Seine Tante. Und Maria aus Magdala, seine – was eigentlich? Vertraute, Geliebte, Freundin, Verbündete? Sie laufen nicht weg. Es ist
nicht ungefährlich, was sie tun. Man sympathisiert nicht mit Rebellen. Dennoch bleiben sie. Das Dennoch ist ihr Protest. Sie können nichts tun, außer da sein. Das ist so ein Frauending, sagen die
einen. Mitleid nennen es die anderen. Wo ihre Wut ist, wissen wir nicht. Sie ist nicht zu sehen. Vielleicht hat sie sich verwandelt: zu Mut in kleinen Portionen.
Später:
Jesus schreit. Das will man nicht hören. Helden sterben lautlos. Aber Jesus schreit. Schreit seine Ohnmacht heraus. Wo sind die Freunde? Pilatus isst das letzte Hühnerbein. Die Soldaten haben
Feierabend. Der Hass kommt vorbei und lästert: „Hilf dir doch selbst. Zeig, was du kannst.“ Jesus schreit. Meine Wut stimmt ein.
Noch später:
Jesus stirbt. Der Himmel verdunkelt sich.
Gott schweigt. Ewig und drei Tage.
Dann wischt Gott das Blut auf.
Malt damit ein Herz.
Gott sieht rot. Morgenrot.
Am Morgen danach tritt Herr Müller auf die Straße. Es ist still, sehr still.
„Wut“, sagt Gott. „Kenne ich.“
„Du?“, fragt Herr Müller.
„Wut ist enttäuschte Liebe“, sagt Gott. „Aber wer wütend ist, ist noch lebendig. Wer wütend ist, ist noch nicht kalt. Wer wütend ist, dem ist noch nicht alles egal. Du kannst die Wut
zurückverwandeln.“
Herr Müller weiß nicht so recht, wie das gehen soll.
„Durch Übung“, sagt Gott. „Liebe ist die einzige, die dich retten kann. Such nicht im Sturm. Such nicht im Feuer. Warte nicht auf das große Beben. Ich bin der stille, sanfte Hauch.“
Herr Müller ist nicht gut im Spüren. Aber irgendetwas geht ihm gerade unter die Haut.
Kann man auch hören: Gesendet am Karfreitag im Deutschlandfunk, 18. April 2025 ,
Kara (Kummer, Klage)
Gott ist gestorben.
Mit schwarzen Flügeln fliegt er davon.
Ich bleibe zurück, unruhig,
weil ich nicht weiß, was jetzt zu tun ist.
Wer kümmert sich um die Wildgänse auf den Wiesen?
Wer weiß, wie man ein Herz flickt?
Wer bestellt den Regen?
Wer backt das Brot?
Am Boden ist Totenstille.
Selbst der Wind hält die Luft an.
Du musst atmen, sagt Gott.
Damit sich etwas bewegt.
Selig sind die Narren

Als Jesus kommt, gucken alle erstmal in die falsche Richtung. Weil, ein König müsste doch mit einem Privatjet kommen oder mindestens mit einer Limousine (nur Tesla geht jetzt nicht mehr). Vielleicht auch mit der Bahn, weil Jesus so einen Ruf als Öko hat, dann aber wenigstens erste Klasse. Nur: Da kommt nichts. Am Horizont gähnende Leere. Bis von der anderen Seite ein Esel herantrottet, gemächlich, weil hier und da sich noch ein Löwenzahn zum Fressen anbietet.
So ein Esel ist sich der Tragweite seiner Rolle nicht bewusst.
Er versteht auch nicht zu glänzen wie ein Pferd. Aber zum Glück ist sein Reiter geduldig. Wobei – er reitet ja gar nicht. Er sitzt. Besonders majestätisch wirkt das nicht; sitz mal auf einem Esel, die Beine baumeln ins Nichts, und das Tier tut sowieso, was es will. Du brauchst gar nicht erst versuchen, es zu beherrschen. Du kannst froh sein, wenn es läuft. Jesus sieht aus, als koste er die Verwirrung aus. Der Esel trottet am roten Teppich vorbei. Ein Staatsbesuch sieht anders aus, die Anzugträger wissen nicht, wohin mit sich, und auch der Herr Bischof zögert, seinem König zu folgen, wegen der italienischen Schuhe, die sehr empfindlich sind.
Die Leute aber ziehen ihre Jacken aus, werfen Schal und Hemd auf die Straße, brechen Zweige von den Bäumen, jubeln, streuen Blüten und feiern ihn. Sie haben so die Nase voll von den Eitelkeiten der Oberhäupter, Hosianna, rufen sie. Endlich einer, der sich nicht so wichtig nimmt.
In den Abendnachrichten kein Wort von ihm, nur Krieg und Kämpfe um Macht und Eier, und ein paar Gockel sind auch zu sehen. Aber wer will sich das schon anschauen? Das Leben findet woanders statt. Selig sind die Narren, ruft Jesus, denn sie werden die Ordnung auf den Kopf stellen. Ihnen gehört das Himmelreich! Ob das zu sagen nicht gefährlich sei, fragen einige. Man höre immer häufiger von Zensur, von Repressionen, von Schlimmerem, mit dem zu rechnen sei.
Aber sowas hat Jesus ja noch nie gestört.
Wenn die Welt wankt

Ich mag das rote Radio in meiner Küche. Ich mag den Schaukelstuhl und das glitzernde Kaninchen, das auf meinem Schreibtisch steht. Aber lebenswichtig ist das alles nicht. Bisher musste ich mir noch nie ernsthaft und existenziell die Frage stellen, was lebenswichtig ist. Zum Glück. Weil ich in einem Land lebe, das so stabil ist, dass ich keine Bombe fürchte, die mir aufs Dach fällt. Weil ich nachts ruhig schlafen kann, ohne dass marodierende Gangs durch die Straßen ziehen. Weil es bei allem, was schiefläuft, Rechtstaat, Demokratie und eine freie Presse gibt. Und Erdbeeren vom Markt. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann ist es die Sicherheit, dass das so bleibt.
„Sorry“, sagt Gott. „Sicherheit gibt es nicht. Was ich dir anbieten kann, ist Vertrauen.“
Das hätte ich mir denken können. Sicherheit versprechen nur die Profiteure der Angst. Aber Vertrauen? Worauf?
„Du bist nicht allein“, Gott sagt. „Erstens bin ich bei dir. In dir drin. Ob du’s glaubst oder nicht. Und zweitens sind da die anderen: Freundinnen und Verbündete. Nachbarn und Zufallsbegegnungen. Eine Tante, die wiederauftaucht oder der freundliche Käseverkäufer auf dem Markt. Wenn die Welt wankt, hilft es, sich aneinander festzuhalten.“
„Amen“, sage ich. Unsicher, aber mutig. Zusammen bleiben wir stabil.
Zuversicht

Der Himmel strahlt heute eine gewisse Zuversicht aus,
sage ich.
Jonte nickt. Eine Möwe fliegt vorbei.
Die Möwen, sagt Jonte, sind die Seelen der Matrosen.
Die Möwe kackt auf seinen Kopf. Zum Glück trägt er Mütze.
Die Seele muss sich auch mal erleichtern, sage ich.
Isso, sagt Jonte.
Und dann schweigen wir wieder.
Kurz mal zu Jesus

Kurz mal zu Jesus. Das ist der mit dem Kreuz. Wegen ihm gibt es eine ganze Religion, genau, das Christentum.
Jesus ist schon eine Weile tot. Genauer gesagt: Er wurde getötet. Gekreuzigt. Das war damals eine typisch römische Strafe für Schwerverbrecher. Jedenfalls solche, die keine römischen Bürger waren. Eine Foltermethode, langsam und grausam. Ich glaube nicht, dass Jesus aus freien Stücken gesagt hat: Klar, mache ich. Jesus wurde hingerichtet, weil er unbequem war. Er hat die bestehende Ordnung und Hierarchien in Frage gestellt, er hat Massen mobilisiert (mal vier-, mal fünftausend). Er hat Freiheit für Gefangene und Unterdrückte gefordert. Er wollte die Welt gerechter machen.
Damit seine Botschaft weiterlebt, gibt es die Kirche.
Die Kirche war eine Untergrundorganisation.
Das vergisst man manchmal. Anfangs gab es keinen Reichtum, keinen Prunk, keinen Einfluss. Anfangs war es richtig gefährlich, dabei zu sein. Heute sagen Manche: Die Kirche soll dekorativ sein und Amen sagen und nicht weiter stören. Vor allem soll sie sich nicht in Politik einmischen. Jesus hat ziemlich gestört. Die Mächtigen und die Reichen, er hat die Unterdrücker beim Unterdrücken gestört. Und Männer, die gern vergöttert werden wollten, hat er auch gestört. Eigentlich war das meiste, was er gesagt hat, unbequem und sehr radikal: Liebe deine Nächsten (auch wenn sie anders leben als du). Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. (Warum besitzen einzelne Menschen Milliarden?) Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. (Autsch.) Die Liste lässt sich fortsetzen, nachzulesen in den Evangelien.
Was Jesus sagt, ist unbequem.
Damals wie heute. Die Überlieferungen sind 2000 Jahre alt. Manches wurde nachträglich bearbeitet oder zugefügt. Und natürlich lässt sich nicht alles eins zu eins auf unsere Zeit übertragen. Aber die Botschaft von Jesus bleibt: Ich bin nicht gekommen, Harmonie zu verbreiten, sondern Streitgespräche zu führen. Mischt euch ein. Eine andere Welt ist möglich: Wie im Himmel so auf Erden.
Wer Kirche will, muss mit Jesus klarkommen. Und wer Jesus will, kann nicht zu allem Ja und Amen sagen.
Herzmuskel

Diese Woche ist der Himmel blau und ich gehe wählen.
Am Wochenende hätte meine Oma Geburtstag gehabt, sie wäre dann 103 geworden. Ich hoffe, es gibt Torte im Himmel, denn meine Oma war die Königin der Torten. Torte gab es zu wichtigen Anlässen und
Anlässe hatten für meine Großeltern eine Bedeutung. Der Wahlsonntag war einer davon. Ich sehe sie, wie sie ihre Mäntel anziehen und Hut aufsetzen. „Was wählt ihr?“, habe ich als Kind gefragt.
Wählen schien eine geheimnisvolle und aufregende Sache zu sein. Meine Großeltern erklärten mir, was ein Wahlgeheimnis ist und warum das was mit Freiheit zu tun hat. Denn sie hatten erlebt, wie es
ist, wenn die Demokratie stirbt. Mein Opa konnte sich über das Gebrüll eines Hitlers ereifern, er hat später viele, viele Dokumentationen geschaut. Auch mit mir. Manchmal schüttelte er sich.
Wieder und wieder fragte er: Wie konnten wir so verblendet sein? Wieso haben wir das zugelassen? Willst du mit solchen Leuten am Kaffeetisch sitzen?
Vielleicht ist das nicht das entscheidende Wahlkriterium, aber ein Gradmesser ist es schon: Mit wem würde ich Omas Torte teilen? Sicher nicht mit den Lautesten. Sicher nicht mit Schreihälsen, die
ihre Häme und Hetze über Omas Kaffeetisch ausschütten. Solchen Leuten traue ich auch sonst nichts Gutes zu.
Postkarte: www.editionahoi.de
Heiliger Schrecken

Frau Immergrün zieht sich zurück. Ins Private. „Das kann man ja nicht aushalten“, sagt sie und meint: was in der Welt geschieht. All die Männer, die so tun, als seien sie der Heiland persönlich.
Seit neuestem gibt es auch Frauen unter ihnen. Anfangs hat sie noch demonstriert, gegen die AFD und ihre Hetze, für Klimaschutz und Weltfrieden. Sie hat Kerzen angezündet und mit Engelszungen
geredet. Sie hat auf die Vernunft gesetzt: die USA würden doch nicht wirklich ein zweites Mal Trump als Präsident wollen? Sie wollen. Zusammen mit den reichsten Männern feiert er sich. Und zu
allem Überfluss klebt seit gestern am Briefkasten ihrer Nachbarin ein Sticker mit der Aufschrift „Biodeutsch statt Bio-Fleisch“.
Frau Immergrün ist so müde.
Sie will sich die Decke über den Kopf ziehen und erst wieder aufwachen, wenn die Welt wieder in Ordnung ist. Wenn man ohnehin nichts ändern kann, kann man es auch sein lassen. Selbstfürsorge sei
in diesen Zeiten wichtiger denn je, hat Frau Immergrün gelesen und plötzlich eine so unglaubliche Sehnsucht nach Flausch gespürt. „Ich kapituliere. Ab sofort halte ich mich raus. Statt
Nachrichten schaue ich nur noch Panda-Videos.“
„Aber nein“, sagt Gott, „tu das bitte nicht!“, (und es ist wirklich selten, dass Gott sich einmischt).
„Du!“, ruft Frau Immergrün, „du hast mir gerade noch gefehlt. Du könntest ja was unternehmen. Könntest durchgreifen und die Welt wieder ins Gleichgewicht bringen. Da schwadroniert ein selbstverliebter Präsident, von Gott selbst auserwählt zu sein und du – schweigst.“ Frau Immergrün ist überrascht, wieviel Wut sich in ihr angestaut hat.
Gott versteht das. Aber Gott ist kein Schlägertyp: „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“
Dann ist es still. Nicht mal die Fliege am Fenster wagt es, ihre Flügel zu spreizen. Man könnte meinen, die Welt bliebe stehen. Aber so einfach geht das natürlich nicht. Frau Immergrün schüttelt
ein Kissen auf und überlegt, ob die Wand eine neue Farbe vertragen würde. Irgendwas in Pastell. Gott geht nicht weg. Gott bleibt. Und sagt: „Ich brauche dich. Bitte. Lass mich nicht allein mit
diesen Möchtegern-Göttern, mit ihrem Egoismus und Größenwahn.“
Frau Immergrün hört plötzlich den Schrecken in Gottes Stimme. Und da besinnt sie sich: Nein, denkt sie. Nein, das kann ich dir wirklich nicht antun.
erschienen in: Innehalten_Magazin
Nachhilfe

Hallo Jesus,
du hast geglaubt:
eher kommt ein Kamel durchs Nadelöhr
als ein Reicher in den Himmel.
Du hast gesagt:
Ich bin fremd gewesen
und ihr habt mich aufgenommen.
Du hast geträumt:
von einer Welt, in der Liebe regiert.
Klappt gerade nicht so.
Gib uns Nachhilfe,
wir bleiben dran.
Friedenspfeife

Die Welt ist voll Übel und heimlich wünsche ich mir manchmal, Gott würde durchgreifen. Weil ich selber nicht weiterweiß. Ich sage das natürlich nicht laut, denn ich glaube ja eigentlich nicht an Allmacht. Wenn es sie gäbe, hätte sie in jahrtausendlanger Geschichte ziemlich versagt. Trotzdem sterben Allmachtsfantasien nichts aus. Ein starker Mann soll es richten (wenn es sein muss, auch eine starke Frau). Das ist gerade unglaublich populär. Dass es starke Männer waren, die die schlimmsten Kriege entfesselt haben, ist eine Ungereimtheit, die dabei nicht weiter zu stören scheint.
Eine Seite von mir will also einen mächtigen Gott.
Er soll regeln, was die Weltgemeinschaft gerade nicht hinkriegt. Das wollen die anderen auch, die nennen Gott Trump oder Trump Gott, die Grenzen scheinen da fließend zu sein. Seit neuestem betrachtet sich auch Alice W. als inkarnierte Liebe. Das ist natürlich ein Fake-Profil, die Liebe tritt zwar in vielerlei Gestalt auf, ganz sicher aber hetzt sie nicht, hasst nicht, lügt nicht. Die Liebe ist, anders als die Äußerungen von Alice, freundlich, sie ereifert sich nicht, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen. Der Liebe geht es nicht um Macht, sondern um Miteinander.
Jesus raucht eine Friedenspfeife aus Zucker und sagt: „Gott ist die Liebe, also wird das mit dem Durchgreifen nichts.“ Ich sage: „Schade“, und Jesus sagt: „Macht nichts, Gott ist in den Schwachen mächtig.“ Ich wende ein, dass Schwäche gerade nicht so gut ankommt. Jesus sagt, Schwäche sei noch nie gut angekommen. Damit kenne er sich aus. Die eigentliche Stärke läge darin, das auszuhalten. „Aber Liebe heißt nicht, alles zuzulassen. Weil dann aus Liebe Missbrauch wird.“
Dann bietet er mir einen Zug aus seiner Pfeife an. Ich schüttele den Kopf, weil ich keinen Zucker esse. Er nickt und lächelt, mit so viel Verschiedenheit können wir leben.
Kinderspiel

Als am 24. Dezember der Krieg fortgesetzt werden soll, geht Marie in die Kommandozentrale des Heeres und sagt zu ihrem Gatten, dem General: »Hier, dein Kind.«
Sie legt den Säugling in seinen Arm, händigt ihm ein Fläschchen trinkwarme Milch, Windeln und ein Plüschkrokodil aus. Der General ist so überrascht, dass ihm kein einziger Befehl einfällt: »Aber wie stellst du dir das vor? Ich kann nicht, ich habe zu tun!«
»Ich auch«, erwidert Marie. »Du bist dran.«
Die Tür schließt sich hinter ihr, und da steht der General mit einer Packung Windeln und einem Plüschkrokodil und bevor er sich einen Überblick über die Lage verschaffen kann, beginnt das Kindlein erst zu jammern, dann zu schreien, sodass es dringend herauszufinden gilt, wie es zu beruhigen ist. Bei dieser Art von Lärm lässt sich unmöglich ein anständiger Krieg führen. Das Kind muss befriedet werden. Was nicht unbedingt zu den Kernaufgaben des Generals gehört. Außerdem kommt es sehr ungelegen. Krieg ist schließlich kein Kinderspielplatz und der Gegner wartet nicht, bis ein Säugling gewickelt ist.
Eine Tagesmutter aufzutreiben, erweist sich in der Eile als aussichtslose Mission. Tagesmütter gehören nicht zum Profil einer Armee, weswegen der General den Gefreiten Kösters zur Betreuung abkommandiert. Überraschenderweise ist der Gefreite nicht abkömmlich. Er hält bereits selber zwei Babys im Arm. Zwillinge, geboren am Nikolaustag. Überdies habe auch der Feind Probleme mit Babys. Ob man die Schlacht verschieben könne, am besten auf die Stunde während des Mittagsschlafs, dann allerdings ohne schweres Geschütz, um die Kleinen nicht zu wecken. Schlecht gelaunte Säuglinge stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. An ein geordnetes Kriegsgeschehen ist nicht mehr zu denken. Aufklärer des Heeres bringen übereinstimmende Kunde: Sämtliche Frauen inner- und außerhalb der Landesgrenzen seien aufgebrochen und haben den Männern Babys in die Arme gedrückt: »Hier ist dein Kind. Hier ist deine Nichte, dein Neffe. Brüderchen und Schwesterchen.« Nach Angaben des Geheimdienstes liegen nun Hunderte, nein Tausende Säuglinge in Uniformsarmen, um gefüttert, gewickelt, gewiegt zu werden. Auch Terroristen und Söldner, so hört man, seien außer Gefecht gesetzt und haben alle Hände voll zu tun, um Milch zu wärmen und hungrige Münder zu stillen, sodass an einen anständigen Krieg überhaupt nicht mehr zu denken ist.
Der General ist außer sich. Auf eine derartige Situation ist er nicht vorbereitet. Es bräuchte einen Krisenstab, aber im Augenblick ist der General mit einer erheblich größeren Krise beschäftigt: Das Plüschkrokodil ist verschwunden, und wenn es nicht innerhalb der nächsten dreieinhalb Minuten wieder auftaucht, droht die Welt unterzugehen. Er weiß nicht, wo ihm der Kopf steht. Die Befehlskette funktioniert nicht mehr. Der Herrscher des Landes jagt gleich drei Säuglingen hinterher, die über das Muster seines seidenen Teppichs krabbeln. Sein Motto war immer: Je mehr Kinder, desto besser, und deshalb hatte er zur Sicherheit Cynthia, Olivia und Diane gleichzeitig befruchtet. Aber damals hatte er ja nicht ahnen können, wohin das führen würde. Dass er die Saat seiner Lenden nun plötzlich selbst an der Backe beziehungsweise in den Armen hatte. Von wo aus sie immer wieder entflutschte, es war schlicht unmöglich, drei Säuglinge gleichzeitig zu halten. Er brüllt, sein Berater möge erscheinen, aber plötzlich. Aber Brüllen ist keine gute Idee, weil die Babys direkt einstimmen. Der Lärm übertrifft jeden Tornado, und außerdem ist der Berater damit beschäftigt, seine eigene Zweijährige einzufangen, die gerade im Begriff ist, mit einer Handgranate Fußball zu spielen. Überall sind plötzlich Kinder, winzige, quirlige, sehr lebendige Kinder, dass man keine Hand mehr frei hat, um ein Maschinengewehr zu bedienen. Und niemand, wirklich niemand will seinen Platz im Panzer mit einem Säugling in voller Windel teilen.
Es ist ein Albtraum.
An Krieg ist wirklich nicht mehr zu denken.
Frohe Weihnachten.
aus: Der Stolperengel. 24 funkelnagelneue Weihnachtsgeschichten, Herder Verlag
mit llustrationen von Nina Hammerle
Kürbis statt Kapitulieren

Rilke sagt, der Sommer war groß, die Kirchen feiern Erntedank und durch meine Timeline rollen Kürbisrezepte. Der Herbst ist die sentimentalste der Jahreszeiten. Über allem liegt ein Goldfilter. Was jetzt nicht getan ist, wird nicht mehr getan. An den Türen hängen Kränze aus Hagebutten (fünf Euro der Zweig), die Welt soll bitte draußen bleiben. Altäre werden mit Möhren und Pastinaken und Ährenbündeln geschmückt, dabei greifen die meisten doch lieber zur toskanischen Gemüsepfanne aus dem Tiefkühlregal. „Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land“, singen ein paar Textsichere und denken dabei an die Tüte mit den Kressesamen, die immer noch im Schrank liegt.
Alles, was ich geerntet habe, sind zwei Kastanien.
Sie haben es irgendwie in meine Jackentasche geschafft, man kann sie weder essen noch konservieren, in drei Wochen werden sie schrumpelig sein, aber jetzt fühlen sie sich gut an. Jesus hat sich auf den Altar gesetzt und pult die Körner aus den Ähren. Ich sage, er solle das lassen, das sei Deko. Aber von Deko hält Jesus nichts und ernten ist sowieso nicht seine Sache, er sät lieber. Selbst jetzt im Herbst, wo eigentlich alles gelaufen ist. Mit vollen Händen wirft er seine Saat unter die Leute, und wenn die Hälfte seiner Worte unter die Dornen fällt und im braunen Morast erstickt, entmutigt ihn das nicht. Er sagt Worte wie Frieden und Liebe. Das ist auch ein bisschen retro, jetzt, wo man wieder sagen darf, dass die Ausländer raus müssen und die Grünen weg, weil man dann erstmal einen Schuldigen hat. Damit kennt sich Jesus gut aus. Hauptsache, man nagelt wen ans Kreuz, das ändert nichts an den eigentlichen Problemen, aber es lenkt ab. Ich frage, ob ihn das nicht frustriert. Immer das gleiche, die Menschen lernen nichts, auch in 2000 Jahren nicht.
Da möchte man doch den Kopf in den Acker stecken.
Aber Jesus ist selber abgelenkt, er scrollt durch Kürbisrezepte. „Guck mal“, sagt er, „das kenne ich noch nicht. Das probiere ich heute Abend aus. Kommst du? Bring mit, wen du willst, der Topf ist groß.“ Ich will einwenden, dass Suppe auch keine Lösung ist. Aber dann halte ich mich an meiner Kastanie fest und nicke tapfer, weil Jesus schon immer mehr fürs Tun als fürs Lamentieren war. Kürbis statt Kapitulieren.
Sandkornsegen

Gott sitzt im Sand
und segnet dich
Sandkorn für Sandkorn
rieselt in die Lücken
die du nicht zu füllen brauchst
Geh, sagt Gott. Ich bleibe
Gott sitzt im Sand
und segnet dich
Sandkorn für Sandkorn
Segen
aus: Wohnzimmerkirche im September
Streik

Als die Freiheit streikte, stand sie mit einem selbstgebastelten Schild in der Fußgängerzone. Sie stand ganz allein da und tat mir leid, weil niemand sie beachtete. Irgendwer protestiert ja dauernd wegen irgendwas; fürs Klima, gegen den Krieg – in der Ukraine oder im Gaza, von Afrika rede ich erst gar nicht, ich bin schon froh, wenn es am Küchentisch friedlich ist. Damit habe ich genug zu tun.
Ich sehe, wie die Freiheit tapfer ihr Schild in die Höhe hält: „Unterstützung gesucht!“, lese ich, und spüre, wie Ärger in mir hochkriecht. Was sollen denn andere sagen! Die Freiheit kann doch machen, was sie will, während unsereins um acht im Büro sein muss und die Waschmaschine piept und die Kinder wollen Schokopops und anschließend muss man sie zum Zahnarzt schleppen ob sie wollen oder nicht. Man muss die Steuererklärung machen, sich für eine Zahnzusatzversicherung entscheiden, muss aufgeklärt sein über die Gefahren der KI, muss Abkürzungen kennen, um mitreden zu können, muss Katzenbilder in der Familiengruppe posten – was denn noch alles? Ich steigere mich da so richtig rein, plötzlich tut mir die Freiheit gar nicht mehr leid, im Gegenteil, ich werde immer wütender, weil die Freiheit sowas Anklagendes hat. Als seien wir Schuld an ihrer Misere. Dabei ist sie es doch, die dauernd abwesend ist. Wieso hat sie überhaupt Zeit, da zu stehen, gibt es denn nichts Wichtigeres zu tun? Daran sieht man doch, wie überflüssig sie eigentlich ist. „Eine wie dich muss man sich erstmal leisten können“, rufe ich und erschrecke über die Worte, die da aus meinem Mund kommen. Die Freiheit lächelt müde. „Mich gibt es umsonst“, sagt sie. „Du musst nur aufpassen, dass du mich nicht verlierst.“
Schwimmflügel

„Wir müssen reden“, sag ich und Gott guckt, als hätte sie gerade einen Rollmops verschluckt. Oder er, ich komme da immer noch durcheinander, es verwirrt mich, dass Gott so uneindeutig ist.
„Reden“, sagt Gott, „immer willst du reden.“ Dabei bläst sie ein paar Schwimmflügel auf. Ich lasse mich nicht beirren: „Das Klima, die Rechten, die allgemeine Unzufriedenheit und dann noch die Deutsche Bahn – das geht doch so nicht weiter. Du musst was tun!“
„Ich tue was“, sagt Gott und reicht mir die Schwimmflügel. Sie sind orange, neonorange.
„Was soll ich damit?“
„Die helfen dir, nicht unterzugehen.“
„Ich kann schwimmen.“
„Ich weiß“, nickt Gott und setzt eine Taucherbrille auf. „Aber damit kannst du dich auch mal treiben lassen.“ Dann taucht sie ab.
„Das ist alles, was du für mich tun kannst?“, rufe ich ihr hinterher. Im selben Moment kreischt eine Möwe, die Luft riecht nach Nivea, und das Wasser glitzert mir entgegen.
Kleine Pfingstgeschichte

Vor 2000 Jahren, es ist Frühling, sitzen fünf Frauen und zwölf Männer unter einem Dach. Vielleicht waren es auch mehr. Fenster und Köpfe sind vernagelt, ihr Raum ist eng. Es ist gerade mal 50 Tage her, da wurde ihr Freund umgebracht. Wurde gefoltert und an ein Kreuz genagelt, wurde hängen gelassen, bis er tot war. Und allen, die zu ihm gehörten, wurde gedroht: Euch kriegen wir auch noch. Seitdem ist nichts mehr sicher. Zwar treffen sie sich auch nach Jesu Tod regelmäßig. Aber die Angst sitzt immer dabei. Obwohl er tausendmal gesagt hat: „Fürchtet euch nicht!“
Anfangs, in den ersten Wochen, war alles noch so lebendig. Da war er noch da. Beim Essen, wenn sie zusammensaßen, unterwegs. Sie spürten noch seine Kraft. Sie hörten noch seine Stimme: „Der Himmel ist ganz nah. Er hat längst begonnen.“ Mit der Zeit wurden die Worte leiser, bis sie schließlich ganz verstummten.
Seit zweitausend Jahren warten fünf Frauen und zwölf Männer auf ein Wunder. Vielleicht sind es auch mehr. Und plötzlich, an einem ganz normalen Tag im Frühling, passiert etwas. Es beginnt mit einem Kribbeln. Im Bauch oder in der Herzgegend. Aus dem Kribbeln wird ein Brennen, es entfacht sie zu neuem Leben. Plötzlich erinnern sie sich wieder: „Wo sind eigentlich unsere Träume hin? Wie konnten wir die vergessen?“
Sie öffnen die Tür und stürmen ins Freie. Viel zu lang haben sie hinter den Mauern gehockt. Viel zu lang haben sie geglaubt, jedes Wort aus seinem Mund konservieren zu müssen, damit bloß nichts verloren geht.
Plötzlich ist die alte Begeisterung wieder da, plötzlich haben sie wieder Rückenwind: Eine stimmt ein Lied an. Einer dichtet eine Ode an die Freiheit. Gemeinsam rufen sie: „Wir sind mehr!“ Alle reden durcheinander, das ist kein Chor, das ist Chaos. Und Gott schwebt über dem Chaos und ist froh, dass wieder Leben in ihnen ist.
Auf der Straße bringen sie den Alltag ins Stolpern. „Was sind das für Leute?“, fragt eine Passantin.
„Ist denn schon Feierabend?“, wundert sich ein Kommunalbeamter.
Und ein Priester empört sich: „Die sind doch betrunken!“ Hunde bellen und ein Huhn entwischt dem Beil des Schlachters.
„Hier kommt die Zukunft“, rufen sie. „Und sie beginnt jetzt! Die Alten werden ihre Träume erzählen. Die Jungen werden ihre Utopien leben. Zusammen werden wir Prophetinnen und Propheten sein!“
Ein Kreis aus Menschen bildet sich um sie. „Sind das nicht die, deren Anführer getötet wurde? Wie kommt es, dass sie lachen?“
Erklären können sie das nicht. Trotzdem versuchen sie es. Sie stammeln und verheddern sich. Aber ihre Worte erzeugen ein Echo.
Wir können es hören: Jetzt.
So oder so ähnlich erzählt es die Bibel in der Apostelgeschichte
aus: Fernseh-Wohnzimmerkirche zu Pfingsten in der ARD. Kann man hier nachschauen:
https://www.ardmediathek.de/video/gottesdienst/pfingstgottesdienst-ueber-den-ur-schall/das-erste/
Sonntagsgebet

Du im Himmel,
wir wollen keinen Krieg
statt Panzer wollen wir Pfirsichblüten
wir wollen Geld ausgeben für Kinder
Armut ist ein tristes Kleid
Wir wollen kein Hochwasser
und keine Erdbeeren im März
die Erde liebhaben wollen wir
Wir wollen keine Schmerzen
aber wenn sie da sind
wollen wir Hände die uns halten
und niemand fällt heraus
Wir wollen gerechte Renten
und geteilte Träume
Wir wollen Leben
das nach Zukunft schmeckt
Leinenweiß

Ich nehme die Schuld
und lege sie in ein Bett
aus gestärkten Leinen.
Schlaf, sage ich,
die Nacht singt dir ihr Wiegenlied.
Ich bleibe drei Atemzüge,
dann gehe ich durch die Schwärze davon.
Der Mond geht unter.
Die Luft wird leicht.
Am Horizont das Licht.
Die Schuld träumt
einen zarten Traum.
Am Morgen ist sie verwandelt,
weiß der Himmel wie.
Non. Nein. Nö.

Heute Morgen höre ich eine Andacht anlässlich des „Frauenkampftages“, so nennt die Pastorin ihn und beginnt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Nö. Nö, ich möchte keinen Gott mehr in einseitig patriarchaler Sprache feiern. Auch nicht aus Traditionsgründen. Es gab auch mal die Tradition, Hexen zu verbrennen, Kinder zu schlagen und Hunde in Deiche einzubuddeln, um den Geist der Sturmflut zu besänftigen. Man muss nicht jede Tradition von Ewigkeit zu Ewigkeit schleppen.
Frauen sind ja nicht diese seltene Spezies, sondern mehr als die Hälfte der Menschheit. Angeblich hat Gott diese Menschheit nach dem eigenen Ebenbild geschaffen. Also wohnen in Gott alle Facetten des Menschseins. Warum beschränken die meisten Kirchenmenschen Gott auch im Jahr 2024 auf eine einzige, nämlich den Vater?
Nö, ich möchte Weiblichkeit auch nicht mitgemeint denken. Wer einen so kleinen Wortschatz hat, wer keine weiteren Bilder von Gott findet, ist kein Traditionalist, keine Traditionalistin, sondern phantasielos oder denkfaul. Was für ein armes Bild, wenn Gott eine so übergroße Männlichkeit bräuchte, um zu existieren. Sprache schafft Wirklichkeit: Wenn Gott eine Weltgeschichte lang männlich gepredigt wird, werden Männer vergöttert. So geschehen in den Zeiten des Patriachats. Männer lernen von Kindesbeinen, breitbeinig zu stehen. Frauen müssen das üben.
Ich stehe hier nicht im Namen eines Vaters, Sohnes und wenn es gut läuft einer weiblich angehauchten Geistkraft. Ich stehe hier im Namen einer Kraft, die uns Denken, Fühlen, Entscheiden lässt.
Nö, ich will den Vater, Herrn, Herrscher, König, den Allmächtigen nicht verbieten. Wer Gott weiterhin einseitig männlich feiern will, möge das tun. Ich gehe einfach auf eine andere Party. Adios.
Wohnzimmerkirche "Non. Nein. Nö" vom 8. März
Und. ein Hoch auf die Gleichzeitigkeit

Ich stelle mir vor: ein Tag, an dem alle anziehen, wovon sie insgeheim träumen. Wie Karneval, nur in echt. Sibylle zum Beispiel trägt ein Kleid aus 943 Federn, die hat sie alle eigenhändig angenäht. Weil sie sich mal wie ein Vogel fühlen will. Paul trägt Pailletten zum Blaumann. Igor trägt wie immer Jeans und Wollpullover, weil er sich darin am allerwohlsten fühlt und zutiefst Igor ist. Frau Piepental hat ihren Petticoat rausgeholt und niemand sagt: Na wissen Sie, in Ihrem Alter…
Es gibt Könige und Draufgängerinnen, es gibt Nietenhosen und Zweireiher, Kopftücher und Knickerbocker, es gibt grau und rosa. Es gibt Kippa und Krawatte, und Josef steht in seinem Prinzessinnenkleid dazwischen und fällt überhaupt nicht auf, weil er dazugehört. So wie alle dazugehören. Und nein, es geht nicht darum, wer am grellsten leuchtet. Es geht einfach nur ums Sein. Und niemand haut das eigene Sein anderen um die Ohren.
Und Gott schaut sich das an und findet es gut. Das glaube ich zumindest, auch wenn ich es natürlich nicht weiß. Kein Mensch weiß, was Gott denkt, sagt, will, tut. Ich stelle mir vor, wie Gott zwischen all den bunten Menschen steht und sich verbeugt. Das irritiert, also passt es zu Gott. Gott irritiert oft.
Ein paar Leute machen es nach. Sibylle verbeugt sich vor dem Knickerbockerträger, Igor verbeugt sich vor einem kleinen Mädchen mit Hut. Ein Punk verbeugt sich vor Oma Grete, eine Polizistin verbeugt sich vor einer Linksalternativen und umgekehrt, ein Golden Retriever verbeugt sich vor einer misstrauischen Katze.
Einfach aus Respekt vor seinem oder ihrem Sein. Auch vor ihrem Anders-Sein. Eine Verbeugung ist eine kurze Geste. Wer in ihr verharrt, buckelt. Darum geht es nicht. Sondern darum, einander groß zu machen. Wechselseitig und abwechselnd. Anzuerkennen: Du bist anders. Ich bin anders. Und wir gehören als Menschen trotzdem zusammen. Wir werden einen Weg finden, nebeneinander zu leben, ohne einander in den Schatten zu stellen.
Januar

Im goldenen Licht eines Januarnachmittags
bin ich über den See geglitten
und habe Spuren gesehen
von Elch und Hase und Fuchs
und von etwas tapsig Kleinem.
Aber Elch und Hase und Fuchs
habe ich nicht gesehen,
auch keinen Taps gehört.
Trotzdem sind sie da.
Was könnte alles noch da sein,
das ich nicht sehe?
Was könnte alles drin sein
in diesem weißen Jahr?
Auf Anfang

Stell dir vor:
In dieser Nacht setzt dir jemand eine Krone auf.
Weil du es bist.
Weil du immer noch suchst.
Nimm das Wertvollste, das du hast.
Nenn es Sehnsucht. Oder Liebeshunger. Oder Wissensdurst.
Du bist nicht fertig.
Stell dir vor:
In dieser Nacht setzt dir jemand eine Krone auf.
Weil du es bist.
Du wirst sieben Zentimeter größer.
Du wächst in dich hinein
und über dich hinaus.
Dein Glanz legt sich auf müde Gesichter im Bus.
Erhellt die Fischfrau auf dem Markt.
Ist ein Lichtblick für irgendwen.
Du berührst.
Stell dir vor:
In dieser Nacht setzt dir jemand eine Krone auf.
Sagt: Greif nach einem Strohhalm
und geh los.
Da draußen wird ein Anfang geboren.
Du wirst ihn finden
zwischen den Räumen.
Du wirst ihn finden
stolpernd unter einem Stein.
Du wirst ihn finden
in einem sternklaren Augenblick.
Da draußen wird ein Anfang geboren.
Nimm ihn zu Herzen. Füttere ihn. Bring ihn zur Welt.
Wohnzimerkirche "Auf Anfang". 15. Dezember 2023
Möglichkeitsräume

Der Tag ist noch nicht zu Ende. Ein paar Stunden haben wir noch und was könnte in diesen Stunden alles geschehen! Und damit meine ich nicht die fürchterlichen Dinge. Ich meine keine weiteren Katastrophen, keine neuen Tragödien. Ebenso wäre es doch möglich, dass genau jetzt irgendwo auf der Welt etwas Wunderbares passiert. Und wenn nicht jetzt, dann vielleicht in einer halben Stunde. Wir brauchen Möglichkeitsräume. Das sind Räume, in denen alles drin ist. Innere Räume, in die man hineingehen kann und sich vorstellt, was noch nicht ist, aber sein könnte: Zum Beispiel könnte heute Abend Wladimirs Herz warm und laut sein, und er stoppt einen Krieg. Der Papst könnte seine Verlobung mit Alfonso bekannt geben und die ganze Kurie feiert Junggesellenabschied. In seinem unergründlichen Ratschluss könnte Gott alle SUVs in Lastenfahrräder verwandeln. Eine rechtsextreme Partei könnte einen Ausflug ins Bällebad machen und nie wieder auftauchen. Irgendwo auf der Welt könnte sich ein Wunsch erfüllen, könnte jemand sagen: Ich habe mich geirrt, könnte ein Topf Basilikum überleben. Irgendwo auf der Welt könnte Frieden beginnen, in einem Hinterzimmer, bei einer Verhandlung, an einem Küchentisch. Es wäre möglich. Vielleicht genau jetzt.
Gleichzeitig

Alles hat seine Zeit
Nachrichten hören
Playlist auf laut stellen
Widersprechen
lernen, was ich nicht weiß
Mitgefühl zeigen
den Kopf in ein Kaninchenfell vergraben
#erntedank

Jesus streift durch die Felder und lässt seine Hand durch die Ähren gleiten. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt und wonach es riecht: nach Staub und frischem Brot und nach zuende gehendem Sommer. Die Sonne steht tief, es ist Nachmittag und das Licht färbt seine Haut golden. Ich frage mich, ob ich genauso glänze wie er. Manchmal rauft er eine Ähre und pult die Körner raus. „Karge Ernte“, sage ich und wundere mich, denn es ist nicht sein Feld und nicht er war es, der gesät hat. Er schüttelte den Kopf. „Ich ernte nicht“, sagt er, während er auf einem Korn knabbert. „Ich habe keine Scheune, nicht mal einen Küchenschrank, in dem ich das Mehl lagern könnte. Ich habe nichts.“ Ich will widersprechen, will sagen: „Du hast eine Menge: Freunde und Unterstützerinnen, du hast Mut und Vertrauen, mehr als jeder Küchenschrank fassen könnte.“ Aber bevor ich den Mund öffne, schüttelt er den Kopf. „Ich möchte nichts haben“, sagt er leise und bestimmt. „Ich möchte leben und lieben, nehmen und geben, ich möchte mich verschwenden. Ich möchte sähen, während ich weitergehe, unterwegs möchte ich einer Blume Wasser geben und einem hungrigen Huhn ein paar Körner hinwerfen. Ich möchte teilen, was ich nicht besitze. Ich möchte Wörter sammeln und sie mir eine Zeitlang auf die Zunge legen, bevor ich sie an anderer Stelle wieder fallenlasse. Ich möchte mir etwas zu Herzen nehmen, ohne es festzuhalten.“ Seine Sätze berühren mich, sie sind so schlicht, ich will sie unbedingt behalten, da vibriert mein Handy und lenkt mich kurz ab. Eine Push-Up-Nachricht meldet fallende Aktienkurse. Ständig bekomme ich solche wichtigen Mitteilungen, ich weiß nicht, wie man die ausschaltet. Ich müsste es recherchieren, genau wie ich mehr über Aktien wissen müsste, wegen der Rente und auch, um mitreden zu können. Als ich das Handy wieder wegstecke, ist die Sonne hinterm Horizont verschwunden. Und auch der Glanz. Ich merke, dass ich Hunger habe. Jesus kramt in seinen Taschen und fischt eine halbe Tüte Salzlakritz heraus. Ich stecke mir zwei in den Mund, obwohl ich kein Lakritz mag. Aber in regelmäßigen Abständen probiere ich sie wieder, Vorlieben ändern sich. Früher konnte ich nicht genug von Bifi bekommen, das ist so eine Minisalami in Plastikhaut. Heute verursacht mir allein schon der Geruch Übelkeit. „Gut“, sagt Jesus, „dass du keinen Vorrat angelegt hast.“
Poolparty

Im Süden ist es heiß und trocken, die einen kleben auf der Straße fest, die anderen preisen, dass es mal wieder richtig Sommer ist. Ein Sommer, in dem man den Pool im Garten füllen kann und Schirmchen ins Cocktailglas steckt. Was man nicht ändern kann, muss man feiern. „Ihr könnt was ändern“, ruft Jesus, aber die Musik spielt anderswo und Jesus ist sowieso ein Spielverderber. Immer wenn man gerade Spaß hat, erinnert er an die anderen, die keinen Spaß oder keinen Pool haben, erinnert er an die, für die Wasser kein Freizeitvergnügen, sondern Überleben bedeutet. Alle gähnen, jetzt kommt die Predigt. „Lass es halt regnen“, ruft einer und der Rest johlt, „du bist doch Profi in Sachen Wunder!“ Eh klar, dass niemand an diese Geschichten mehr glaubt. Wunder sind keine sichere Bank. Das ist unbequem, weil man bis zum nächsten Wunder doch wieder selbst ran muss, um die Welt zu retten. Dabei ist es schon anstrengend genug, das Gefühl der eigenen Ohnmacht nicht an die Oberfläche zu lassen. Ohnmacht ist ein Eisberg, was man sieht, ist nur die Spitze, aber das Eis schmilzt ja sowieso gerade, was soll’s also – lasst uns feiern und den Sommer genießen. Und überhaupt: war da nicht was, verwandelt Jesus selbst nicht Wasser in Wein, warum dann nicht gleich in einen Wildberry Lillet?
Aber Jesus hat sich aus dem Staub gemacht, wahrscheinlich reicht er das Wasser gerade den Klimakleber*innen, auf dem Asphalt ist es heiß. Die nerven, Jesus nervt, dass entweder Waldbrandgefahr oder Überschwemmung ist, nervt auch.
Ich verlasse die Party und beschließe, ins Freibad zu gehen, da dürfen wenigstens alle rein. Das Wasser ist kalt, kälter als gedacht. Ich sitze am Rand und stippe die Zehen ins Becken, da sehe ich Jesus übers Wasser kommen. Er hält ein selbstgemaltes Plakat in der Hand: „Heute schon an die Party von Morgen denken: Save the planet.“ Die Leute schwimmen einen großen Bogen um ihn, als sei er ein Gespenst, ganz allein steht er in der Mitte der Wasserfläche. Fast könnte er einem leidtun. „Komm“, ruft er. Ich hätte mich gern weggeduckt, doch er hat gesehen, dass ich ihn sehe. „Ich kann nicht“, sage ich. „Dann schwimm halt. Oder willst du wirklich, dass die Welt baden geht?“ Natürlich nicht. Also stehe ich auf, nehme Anlauf und springe rein ins kalte Wasser. Direkt vom Beckenrand. Obwohl das doch verboten ist.
Wie ich mal fast (aber nur fast) reich geworden wäre
„Guten Tag“, sagte der Herr im Blockstreifenanzug, „darf ich mich vorstellen? Wir kennen uns noch nicht. Ich bin ab heute ihr persönlicher Engel, Abteilung strategische Lebensplanung und Anlageberatung. Ich bin ganz für Sie da.“
„Wir siezen uns?“
„Das gehört zu unserer neuen Strategie. Unsere Zielgruppenanalyse hat ergeben, dass Engel nicht mehr ernst genommen werden. Da möchten wir gegensteuern.“
„Aha.“
„Ich habe eine Weiterbildung zum Vermögensberater abgeschlossen.“
„Ach. Von welcher Art Vermögen reden wir?“
„Ich bin spezialisiert auf Vertrauensvorschüsse, Glücksdepots und japanische Aktienfons.“
„Interessant…“
„Nicht? Wie reich möchten Sie denn werden?“
„Das kann ich mir aussuchen?“
„Als Engel performen wir mit Skills, die über die eines gewöhnlichen Bankberaters hinausgehen.“
„Erstaunlich.“
„Sie sagen es. Wenn das nur mehr so sehen würden.“
„Was unterscheidet Ihr Institut denn von gewöhnlichen Banken?“
„Im Grunde nichts mehr. Wir betreiben natürlich Traditionspflege. Unsere Geschäftspapiere ziert das Wasserzeichen „Glaube, Liebe. Hoffnung“. Dezent, aber wirkungsvoll. Unsere Marketingabteilung nutzt eingeführte weiche Bilder wie Himmel, Regenbogen, etcetera. Und dann haben wir natürlich starke Identifikationsfiguren…“
„Sie meinen Jesus?“
„Zum Beispiel.“
„War der nicht gegen Reichtum?“
„Denkt man immer, aber auch Jesus verfügte über ein beträchtliches Vermögen, verteilt auf diverse römische Banken.“
„Sie scherzen.“
„Mitnichten. Denken Sie an den Schatz im Acker. Ein älterer Kollege von mir war sein persönlicher Anlageberater.“
„Ich glaube, Sie erfinden das gerade. Ich habe noch nie von Engeln wie Ihnen gehört. Eigentlich will ich auch gar nicht, dass es solche Engel gibt.“
Die Blockstreifen wellen sich, und mein Gegenüber löst sich in Spielzeuggeld auf, das der Wind in alle vier Himmelsrichtungen verteilt, bis die Luft wieder rein ist.
Tja.
Wieder nix.
Laufende Liste

Ich mag Freiheit. Ich mag, dass auf der Straße ein Klavier steht.
Ich mag keine Musik, die mich nervt. Jazz zum Beispiel.
Ich mag keine Pauschalisierungen. Ich mag Menschen,
die eine Haltung haben und sie begründen können.
Ich mag Menschen, die gelenkig genug sind, ihre Haltung zu ändern.
Ich mag Yoga. Ich mag Selbstironie.Ich mag es nicht,
wenn zu viel erwartbar ist. Ich mag Listen.
Ich mag kleine Häkchen, die mir zeigen, dass ich schon viel geschafft habe.
Ich mag es nicht, zu prokrastinieren. Manchmal tue ich es trotzdem,
weil ich das Kribbeln mag, wenn es eng wird. Ich mag Kirchentagsschals.
Ich werde nie einen tragen. Ich mag Widersprüche.
Ich mag Eis im Allgemeinen. Außer Nuss. Und Banane. Ich mag das Gefühl von Danach
und das Gefühl von Davor. Gerade bin ich genau dazwischen.
(to be continued)
Konfetti für alle!

Als Gott die Welt auf den Kopf stellt, öffnet sie den Himmel und ruft: "Hereinspaziert, hereinspaziert!"
Als erstes kommen die Zweifler um die Ecke und können es nicht glauben: "Echt jetzt, Himmel für alle, einfach so? Gibt’s denn sowas?"
Und Gott sagt: "Wenn ihr dran glaubt, dann gibt es das."
Und sie wirft 5 Hände Regenbogenkonfetti und verschenkt ein Lächeln, das einfach bezaubernd ist.
"He", rufen da welche. "So geht das aber nicht. Erst sind wir dran. Schließlich waren wir jeden Sonntag in der Kirche. Morgens um 10. Ohne Frühstück! Wenn die da 5 Hände Konfetti kriegen, verdienen wir 10! Und doppelten Zauber, mindestens."
Gott ist ein bisschen ratlos, weil Zauber plus Zauber ist Zauber, und Himmel plus Himmel ist immernoch Himmel.
"Moooooment", rufen da noch andere, "nicht so schnell! Wir waren schließlich von Anfang an dabei. Wir beten seit 27 eineinhalb Jahren morgens, abends und mittwochs sogar mittags. Wir haben die Bibel einmal von vorn und einmal von hinten gelesen. Und wir waren auf jedem Kirchentag. Wenn jemand als erstes in den Himmel kommt, dann jawohl wir! Die anderen, die müssen erstmal nachsitzen: 100 Vater Unser und einmal Pilgern auf dem Jakobsweg!"
Es wird sehr laut am Himmelstor, es donnern die Stimmen, es fliegen die Funken, so dass selbst die Engel sich die Ohren zuhalten und sich wundern. Der Himmel ist doch so groß, so unendlich groß.
"Beruhigt euch", ruft Gott, "es gibt Platz genug für alle! Für die Zweiflerinnen und für die Frommen, und ihre 1000 Gebete passen auch mit rein. Für die mit dem klitzekleinen Glauben und selbst für die Schurken gibt es irgendwo ein Plätzchen (aber nicht ganz vorn, das dann doch nicht)."
"Das ist ungerecht", schreien die Frommen. "Wozu haben wir denn unser ganzes Leben gebetet?"
"Wozu habt ihr geküsst?
Wozu habt ihr Regenbögen bewundert?
Wozu eure Nasen in den Wind gehalten?
Wozu habt ihr in Sommernächten ins Feuer geschaut?
Wozu die Katze des Nachbarn gekrault?
Weil es schön ist. Einfach, weil es schön ist.
Hereinspaziert!
Die Letzten sollen auch mal die ersten sein, die Langsamen nach vorn, und ein Mohnblütenteppich für die Verzagten.
Wer nichts zu bieten hat, braucht alles das doppelt so sehr. Kein Neid, hereinspaziert, der Himmel ist groß, Konfetti für alle!"
Gott mit Sternchen. Wie wollen wir reden?

Als Gott mir vorgestellt wurde, war ich 14. Vorher hatte ich schon manchmal von ihm gehört – und ja, ich sage „ihm“, denn Gott war ein Herr. Ein bisschen aus der Zeit gefallen, so wie Herr Busche von nebenan, der sein Geld als Klavierlehrer verdiente und aus dessen Wohnung manchmal schwer zugängliche Musik kam. Herr Busche trug immer einen Hut und sprach nicht viel. Ich grüßte ihn schüchtern und irgendwie auch ehrfurchtsvoll, denn er war ganz anders als mein Vater, der am liebsten Blasmusik hörte und auch gegen Schunkeln nichts einzuwenden hatte.
Gott schunkelte nicht. Er hatte genug damit zu tun, die Welt in Gut und Böse zu teilen und vorwurfsvoll zu gucken wegen der Sache mit seinem Sohn, auf den wir nicht genug aufgepasst hatten.
Das war sehr anstrengend, und als ich erwachsen genug war, sagte ich, ich bräuchte mal ein bisschen Abstand und das Überraschende war: Gott nickte und sagte „ich auch“. Und dann löste Gott sich auf und tauchte später an ganz anderer Stelle wieder auf, und es begann eine neue Geschichte.
Doch bis dahin sollte es dauern. Zunächst lernte ich, mitgemeint zu sein. Wenn der Pastor „Liebe Brüder“ sagte. Pastorinnen gab es nicht, jedenfalls nicht in der evangelischen Landeskirche da, wo ich aufwuchs. Frauen und Männer seien gleichwertig aber nicht gleichartig, hieß es. Enten bauten ja auch keine Biberdämme und Frauen gehören nicht auf die Kanzel. Dieser Satz brannte sich mir ein, ich stand ihm mit meinen 15 oder 16 Jahren ohnmächtig gegenüber. Als würde mich ein Biologielehrer einer bedrohten Art zuordnen, die es zu erhalten galt. Eine Art, die er und seine Kollegen eingehend studiert hatten. Welche Fähigkeiten sie hat, in welchem Habitat sie sich wohlfühlt, das definierten Männer...
Und auch Frau Engelking, die die Kinderkirche leitete und uns Helferinnen beibrachte, wie man Kindern von Gott erzählt: Als Vater, der alle liebhat, aber auch streng ist. Wenn man nicht tut, was er will, wird er böse. Siehe Sintflut. Den Kindergottesdienst durften Frauen leiten, im Gegensatz zu richtigen Gottesdiensten. Weil Frauen einen natürlichen Draht zu Kindern haben, artgerecht sozusagen.
Das alles fand nicht in den Fünfzigern statt, sondern in den 1980er-Jahren. Wo die Infohefte des Arbeitsberaters, der in unsere Schule kam, bereits genderten. Es gab Informatiker und Informatikerinnen, Köchinnen und Köche, Theaterwissenschaftlerinnen und Theaterwissenschaftler. Theoretisch konnte ich alles werden. Nur nicht Pastorin.
Wollte ich auch nicht. Aber dass Gott das angeblich aus Prinzip auch nicht wollte – das nahm ich ihm krumm.
Es ist schwierig, mit Gott zu diskutieren. Mit Menschen geht das theoretisch besser. Allerdings begegne ich immer wieder Menschen, die sehr genau darüber Bescheid wissen, wie Gott denkt und was Gott will. Das wundert mich. Woher wissen sie das?Über 2000 Jahre wurde die Geschichte des christlichen Gottes überwiegend von Männern erzählt. Sie waren lauter. In einer patriarchalen Gesellschaft kein Wunder. Dass es dabei viel um Macht und nicht bloß um Erleuchtung ging, ist bekannt.
Ein schönes Beispiel ist Junia. In der Bibel schreibt Paulus über sie und einen gewissen Andronikus: „Sie sind herausragend unter den Aposteln und haben sich schon vor mir zu Christus bekannt.“
Eine Frau als Apostel? Auch Johannes Chrysostomus, im vierten Jahrhundert Bischof von Konstantinopel, hebt das besonders hervor: „Ein Apostel zu sein ist etwas Großes. Aber berühmt unter den Aposteln – bedenke, welch großes Lob das ist. Wie groß muss die Weisheit dieser Frau gewesen sein.“
Bis heute lehnt die katholische Kirche das Priestertum von Frauen ab, unter anderem mit der Begründung, es habe keine Apostelinnen gegeben. Und tatsächlich verschwand Junia im Lauf der Geschichte. Oder sagen wir, sie wechselte das Geschlecht. Allerdings nicht freiwillig. Man hängte einfach ein „S“ an ihren Namen. Aus Junia wurde Junias. Sie wurde zum Mann. Zum ersten Mal taucht Junias nachweislich im 13. Jahrhundert auf – bei Ägidius von Rom, einem Schüler des Kirchenlehrers Thomas von Aquin. Nicht gerade als Feminist bekannt. Martin Luther übernahm das. Dabei gibt es den Name Junias in der antiken Literatur sonst nicht, während Junia ein verbreiteter Frauenname war.
Und Junia ist kein Einzelfall. Auch Maria von Magdala wurde über ein Jahrtausend Apostelin unter den Aposteln genannt. Sie war die erste, die dem auferstandenen Jesus begegnete. Und sie wurde verehrt deswegen. Spätantike Texte belegen das.
Im Mittelalter wurde aus ihr eine Sünderin, eine Prostituierte, bis ihr Ruf nachhaltig beschädigt war.
Es ist gar nicht so, dass es im biblisch-frühchristlichen Universum keine Frauen gab. Sie wurden nur mundtot gemacht. Blöd, wenn frau nach Identifikationsfiguren sucht.
Seit 2016 steht in der Einheitsübersetzung übrigens wieder Junia, seit 2017 auch in der Lutherbibel.
Die Bibel erzählt durchaus in verschiedenen Perspektiven von Gott. Überwiegend männlich, weil von Männern geschrieben. Im Buch des Propheten Hosea sagt Gott über sich selbst:
„Ich bin Gott und kein Mensch, ich bin heilig in deiner Mitte .“ Und im 2. Buch Mose antwortet Gott auf die Frage nach dem Namen: „Ich-bin-da.“ Oder einfach „Ich-bin.“ Kein Mann, keine Frau, kein Mensch.
Als ich das zum ersten Mal las, begann eine neue Geschichte.
Eine, die Gott frei lässt. Die Gott nicht unter einen Hut mit Männern steckt. Die Kategorie männlich (genau wie weiblich) beinhaltet so viele Zuschreibungen, die Gott und Menschen festnageln.
Kleiner Exkurs:
Ich bin ein Mensch. Im Körper einer Frau. Ich kann gut zuhören, aber nicht nähen. Ich mache gern Feuer, finde Röcke angenehmer als Hosen und mochte rosa schon, bevor es Prinzessin Lillifee trug. Ich habe keine Kinder geboren und bin glücklich damit. Ich fahre gern Auto, genieße es manchmal, mich anzulehnen und gehe an anderen Tagen vorweg. Ich hasse es, mein Fahrrad zu flicken und freue mich, wenn jemand Spinnen aus dem Weg räumt. Eine Maus würde ich aber jederzeit auf die Hand nehmen. Manchmal bin ich härter als ich will. Ich koche täglich, eine Bratpfanne auf dem Geburtstagstisch wäre für mich keine Beleidigung. Fußballübertragungen langweilen mich, Fashionfragen auch. Ich habe eine Vulva und finde das gut, allerdings habe ich auch keinen Vergleich, wie es mit einem Penis wäre (etwas unpraktischer stelle ich es mir vor).
Was ich damit sagen will: Die Frage, ob ich mich weiblich fühle, spielt für meine Identität keine große Rolle. Ich bin ich. Ich fühle mich gut (jedenfalls im Großen und Ganzen). Und ich möchte in einer Welt leben, in der das jede und jeder von sich sagen kann. In der Menschen dieselben Rechte haben. Einen Rock tragen dürfen und einen Bart. An manchen Tagen zartbesaitet sind, an anderen gestählt. Alle Zeit der Welt mit Kindern verbringen dürfen, ohne sich dafür entschuldigen zu müssen. Oder mit einem Floß den Mississippi queren dürfen oder glücklich hinter Aktenordnern verschwinden. Mit Hüftschwung durch die Straßen gehen oder mit Stiernacken. Und das alles sollte keine Frage des Geschlechts sein, sondern der Sehnsucht: Wer bin ich? Was entspricht mir?
Ich möchte in einer Welt leben, in der es weniger Kategorien gibt und mehr Sein.
Ich bin. Ich bin da.
Gott: ist kein Mensch. Trotzdem brauche ich manchmal Bilder von Gott. Ich brauche Geschichten, die Gott auf die Erde holen. Die davon erzählen, wie andere Gott erleben. Wenn eine Geschichte konkret sein soll, dann kann sie nicht alles offen lassen. Sie malt Bilder in meinem Kopf und in meinem Herz. Ich habe also nichts dagegen, die Geschichte vom Verlorenen Sohn zu hören und kann mich mit ihm identifizieren, obwohl er als Mann beschrieben wird. Allerdings spricht auch nichts dagegen, diese Geschichte als Geschichte einer Tochter zu erzählen. Es handelt sich ja um ein Gleichnis und nicht um eine historische Begebenheit. Es geht nicht um die einzelne Person, nicht um die einzelne Geschichte, sondern um das große Ganze. Und in dem ist es eben so: wenn nichts von Töchtern erzählt wird, dann werden sie auch im tatsächlichen Leben eine untergeordnete Rolle spielen. Sprache bildet Wirklichkeit nicht nur ab – sie schafft auch Wirklichkeit. Das ist ihr Zauber. Und Zauberei kann beides: etwas verschwinden oder etwas erscheinen lassen. Mit den Geschichten, die wir erzählen, entscheiden wir, ob wir eine einfältige oder eine diverse Welt abbilden.
Wenn wir Gott in Geschichten immer wieder darauf reduzieren, Herr oder Vater zu sein, dann machen wir Gott klein. Dann zäunen wir Gott ein. Dann ist das so, als würden wir zu nah an ein unfassbar großes, buntes Mosaik herantreten und nur einen winzigen Ausschnitt betrachten. Und anschließend behaupten, das sei das ganze Bild.
Es ist aber nicht das ganze Bild. Die Erfahrungen, Beschreibungen, Gleichnisse, die Möglichkeiten, von Gott zu erzählen - sie sind so unendlich wie das Universum.
Deshalb lohnt es sich, weiter zu denken und nach den Sternen zu greifen. Auch nach dem Gendersternchen. Nicht um es anderen an den Kopf zu werfen. Nicht als neues Dogma. Sondern um die Sprache zu weiten. Damit wir die Galerie der Bilder Gottes um neue Ansichten erweitern. Damit wir Gott frei lassen, denn Freiheit ist das allererste Gebot: „Ich bin dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. “ Auch aus der Sklaverei einseitiger Bilder und einseitiger Sprache.
Den Herrn mit Hut sehe ich heute manchmal von ferne. Er kommt mir genauso einsam vor, wie damals der alte Herr Busche. Es kann aber auch sein, dass es meine eigene Einsamkeit ist, die ich fühle. Wir haben so wenig gemeinsam. Wie er wohl aussieht, frage ich mich, wenn er den Hut ablegt und die ganze Herrlichkeit dazu?
Auch an Junia und Maria denke ich oft…
Bis ich sie zufällig treffe. In einer Bar, sie sind nicht allein. Sie reden und gestikulieren, zusammen mit vielen anderen feiern sie das Leben. Lachen kommt aus ihrer Ecke, ein freies, kein hämisches Lachen. Ich gehe zu ihnen und spreche sie an, ob sie nicht wütend sind, ob sie nicht kämpfen wollen. „Ach, Wut“, sagen sie. Die haben sie hinter sich. Sie wollen sich nicht mehr abarbeiten an jenen, die Angst haben um Macht und Bedeutung. Sie machen einfach ihr eigenes Ding. Der Herr mit dem Hut sei ohnehin nur eine Projektion, eine Herrschaftsphantasie. Sogar Gott selbst sei seiner müde. Woher sie das wissen, frage ich überrascht. Wissen können sie es natürlich nicht, geben Junia und Maria beide zu. Auch sie nicht, obwohl sie so nah dran waren. „Aber wir können entscheiden, was wir glauben.“
Ich bleibe eine Weile bei ihnen sitzen, es ist so hell und offen in ihrem Kreis, etwas funkelt. Das habe ich lange schon vermisst. Über ihren Köpfen flackern die Lichter in einer Million Farben, und ich wundere mich, mit wem sie alles Umgang pflegen. Selbst Paulus schaut vorbei, Luther und Katharina wagen ein Tänzchen und sind ganz aufgeräumt. „Warum wundert dich das“, rufen sie mir zu. „Alles ändert sich, Sprache sowieso, da sind wir ganz vorn. Wir sind ja nicht mehr im Mittelalter…“ Der Rest geht unter im Stimmengewirr, ich bleibe, ich feiere bis in den Morgen. Später, draußen beim Gehen, fällt mein Blick auf das Leuchtschild über der Tür. „Irgendwas wie Kirche“, steht da. Ich lächele. Wer nennt denn so eine Bar?
Am Sonntagmorgen, Deutschlandfunk. Hier zum Nachhören.
86 400 Sekunden

Stell dir vor: Am Morgen der Welt verschenkt Gott Lebenszeit.
Für jeden Mensch, für jedes Tier, für Olga und Ahab, für die Saurier und die Anemonen, für das Faultier und den Mammutbaum. Lässt regnen so viel Leben, so viel Glück.
Moment, rufen da plötzlich welche. Das ist gar nicht gleichverteilt. Die einen bekommen mehr, die anderen weniger.
Das ist ja total ungerecht!
Und das stimmt. Es ist fürchterlich ungerecht. Die einen haben viel Lebenszeit und die anderen viel zu wenig. Es gibt kein erkennbares System. Als ob sich jemand verrechnet hätte.
Und Gott – schweigt. Wie eine Künstlerin, die ihr Werk nicht erklären will.
Und das Glück? Das ist trotzdem da. Weil Glück nicht rechnet. Glück braucht nicht viel Platz. Glück lässt sich nicht einschüchtern.
Also noch mal von vorn, eine Nummer kleiner:
Am Morgen jedes Tages verschenkt Gott Lebenszeit. Für jeden Mensch, für jedes Tier, für Olga und Ahab, für die Nachkommen der Saurier und für die Anemonen, für das Faultier und den Mammutbaum. Für dich, für mich. Hier, flüstert Gott. Macht was draus.
Die einen machen Picknick, leihen sich ein Pferd, schreiben einen halben Roman, stricken einen krummen Schal, lernen Minigolf, lösen fünf Kreuzworträtsel und eine Gleichung mit vier Unbekannten, teilen einen Schokokuss und schlafen 9,3 Stunden. Sie setzen alles auf diesen Tag.
Andere sind vorsichtiger. Sie halten sich zurück, denn sie wollen die Zeit gut einteilen. Das Spielen verschieben sie auf später, das Picknick verlegen sie an den Küchentisch und schlafen müssen sie ja sowieso. Wenn auch nicht ganz so lang.
Und schließlich gibt es welche, die wollen die Zeit aufsparen. Für etwas Besonders, wer weiß, was noch kommt. Eines Tages, sagen sie. Eines Tages gönne ich mir wirklich was. Die einen sind glücklich. Die anderen sind mittelglücklich. Und die letzten sind gar nicht glücklich.
Und wieder ruft jemand: Das ist ja total ungerecht!
Aber diesmal schüttelt Gott den Kopf: Ihr alle bekommt 24 Stunden mal 60 Minuten mal 60 Sekunden. 86 400 Sekunden Leben. Tag für Tag neu. Und mindestens ein paar davon werden glücken. Macht was draus!
Hütchenspieler

Als Jesus überraschend seine Kirchenmitgliedschaft kündigt, wirft Erna Kozlowski den Staublappen hin. 37 Jahre hat sie den Altar abgestaubt und die Kaugummis der Konfirmanden von den Bänken gepult. Alles für den Herrn Jesus. Aber wenn der feine Herr jetzt zum Dank das Weite sucht, kann sie das auch. Dann macht sie Urlaub auf Mallorca, da träumt sie schon ihren Lebtag von, aber wer nur montags bis samstags Zeit habt, kommt höchstens bis Meschede im Sauerland.
In der Kirche wird es still. Der Organist ist schon vergangenen Herbst an multiplem Organversagen verschieden, und die letzte Konfirmandin meldet sich ab, weil sie jetzt selbst Influencerin ist. Jesus hat das kommen sehen, der Öffentlichkeitsbeauftragte hat ihm dennoch den Insta-Zugang verweigert und stattdessen eine Neuauflage der Bibel in poppigem Pink angeregt. Jesus wirft ein paar Tische um, auch Tastaturen fliegen durch die Luft, eine Mediatorin wird einbestellt, und man gründet nach siebzehn-monatigem Findungsprozess die Stabsstelle Kommunikation, für die sich Jesus aufgrund mangelnder Qualifikation als ungeeignet erweist. Er wird zornig, sehr zornig, und nach dem Zorn kommt die Gleichgültigkeit und was dann kommt, verfolgt niemand mehr.
Aus der Kirche wird ein Zentrum für Zukunftsprozesse. Es erhält einige lobende Erwähnung für energieeffizientes Heizen.
Die Bibel wird auch in Türkis gedruckt.
Erna Kozlowski nimmt eine Stelle als Facility-Managerin in der Filiale einer Imbiss-Kette an. Es heißt, dort träfe sie Jesus öfter umringt von einer beachtlichen Gruppe Neugieriger, er habe erstaunliche Tricks auf Lager, wie ein Hütchenspieler. Aber das kann sich niemand recht vorstellen, so tief würde doch selbst Jesus nicht sinken. Die Pommes aber seien tatsächlich besser als gedacht.
Du im Himmel

Du im Himmel
und unter der Haut
Dein Name ist heilig
deine Wunderwelt komme
Dein Wille geschehe
oben und unten und überall
Gib uns heute, was wir brauchen
Vergib uns
und auch wir vergeben
Sei bei uns, wenn wir uns verlieren
und erlöse uns
Denn du bist Ein und Alles
Kraft und Herrlichkeit und Ewigkeit
Ich suche immer wieder nach Worten, die passen. Zusammen mit Matthias Lemme ist diese Variante des Vater Unsers entstanden.
In der Tradition gibt es Texte, die sind zu eng geworden. In meinem Viertel gibt es einen phantastischen Änderungsschneider. Er hat schon Hosen kürzer gemacht, Reißverschlüsse repariert, einen mottenzerfressenen Schal gestopft - alles so geändert, dass ich es wieder tragen mag. Ich glaube, so kann man auch mit alten Texten umgehen. Man kann sie ändern, damit sie wieder passen.
Bei www.monatslied.de gibt es eine wunderschön vertonte Version dieses Vater Unsers. Wir singen es oft in der Wohnzimmerkirche.
Restwärme

Der Engel hat sich auf Wollsocken genähert, erst in letzter Sekunde habe ich sein Kommen bemerkt. „Jedes Baby bringt eine Portion Geborgenheit auf die Welt“, sagt er. „Das ist eure Rettung. Damit ihr nicht abstumpft. Damit ihr nicht vergesst, wie das ist: Hilflos zu sein und trotzdem Willkommen. Selbst wenn die Umstände Mist sind.“ Ich zucke zusammen, seit wann klingt die Botschaft der Engel so derb? „Ist doch wahr“, sagt er. „Schau dir die Welt an. Ein Stall ist eine Wellnessoase dagegen. Ihr müsst dringend ausmisten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden!“ ruft er und verschwindet. Vielleicht ist das ein Zeichen, denke ich. Dass der Engel keiner von der abgehobenen Sorte ist. Sondern weiß, wovon er spricht. Vielleicht ist dann ja auch das andere wahr: Euch ist heute ein Retter geboren. Ein Kind in Windeln. Im Dunkel zur Welt gekommen, als alle schwarz sahen. Hat ein paar Menschenseelen erwärmt und ist weitergezogen. Aber etwas bleibt. Als wäre eben noch jemand dagewesen. Restwärme fürs Herz.
Helle Tage, gesegnete Nächte, frohe Weihnachten!
Still

Am Morgen jenes fernen Tages rasierte sich Zacharias sorgfältiger als sonst. An jenem Morgen zog er sein bestes Hemd an, das mit den Perlmuttknöpfen. Das hatte er lang nicht mehr gemacht.
Elisabeth sah ihn an und dachte, dass er alt geworden war. Ein alter Mann mit zwei Falten um den Mund und tiefer Melancholie im Blick. Ach du, dachte sie.
Im Haus war es still. Viel zu still. Zacharias räusperte sich, er konnte die Stille nicht gut ertragen. Hier hätten seine Enkel lachen sollen. Er hatte sich immer ein volles Haus gewünscht, kommen und gehen, klein und groß, Elisabeth und er, sie beide mittendrinn. Aber es war kein Kind gekommen. Kein einziges. Elisabeth wurde älter, ihre Versuche wurden routinierter und bekamen schließlich den Beigeschmack der Verzweiflung.
Elisabeth fühlte sich wund an, wundgehofft, und er fühlte sich schuldig. Und auch betrogen um ein Leben, das sie verdient hätten. Sie hörten auf, darüber zu reden. Und irgendwann hörte Zacharias auch auf, dafür zu beten. Denn auch Gott blieb stumm.
Zacharias war Priester, einer von Tausenden, aber immerhin nicht in einem verlorenen Dorf am Ende der Welt, sondern im Tempel. Im Zentrum. Da, wo immer etwas los war. Einer, der anderen Hoffnung machte, ohne selber noch Hoffnung zu haben. Aber er war gut darin. Er war wirklich gut.
An jenem Tag also war er an der Reihe, das Rauchopfer bringen. Deshalb das Hemd. Zacharias küsste Elisabeth flüchtig auf die Wange. „Bis später, Schatz.“
Im Tempel war es bereits voll. Pilgerinnen, Touristengruppen, Gläubige, Krimskramsverkäufer. Zacharias entdeckte ein paar bekannte Gesichter und setzte sein Priestergesicht auf. Warm und verbindlich. Er prüfte, ob die Kohlen glühten, der Weihrauch lag bereit. Die Zeremonie begann. Es wurde still. Zacharias sprach die Heiligen Worte, er kannte sie in und auswendig. Kurz schweifte er ab und dachte, dass er versprochen hatte, später Lammbraten zu besorgen, aber er holte sich zurück und versuchte, mehr Bewegtheit in seine Stimme zu legen. Dann ging er hinein ins Allerheiligste, dorthin durfte ihm niemand folgen. Hier war er allein mit Gott. Was für eine Vorstellung, dachte er. Und dann dachte er kurz, was er Gott sagen würde, wenn Gott wirklich hier wäre. Aber der Raum war leer, bis auf das Gold, das trotzdem glänzte. Stop, ermahnte Zacharias sich. Dies ist nicht der Ort für Zweifel.
Er nahm die Schale mit dem Weihrauch und sah den Engel. Unzweifelhaft stand er da, direkt neben dem Altar. Zacharias wollte etwas sagen, aber was?
„Hab keine Angst“, hörte er. „Euer Wunsch wird sich erfüllen. Elisabeth wird schwanger und ihr bekommt ein Kind und ihr werdet überglücklich sein.“
In Zacharias Kopf stürzte etwas ein. Jetzt hätte er jubeln müssen, hier war das Wunder, das er so lang herbeigesehnt hatte. Aber das einzige, was er dachte, war: Warum? Warum jetzt? All die Jahre, in denen wir so gehofft haben. In denen wir alles versuchten. In denen wir das Glück der anderen gesehen haben, all die vielen bitteren Jahre. Der mühsame Weg, abzuschließen. Und jetzt wieder anfangen? Von neuem anfangen zu hoffen? Zacharias spürte nichts.
„Wie kann ich mir sicher sein“, fragte er. „Wie kann ich wissen, dass es dieses Mal klappt, dass wir nicht wieder enttäuscht werden. Und wie soll das gehen? Es ist zu spät. Wir sind alt. Da wächst nichts mehr. Ich kann das auch nicht mehr, ich…“
„Still“, sagte der Engel und brachte Zacharias mit einer sanften Geste zum Schweigen. „Es liegt nicht an dir. Rede dir nichts ein. Das Leben wird wachsen.“ „Aber“, wollte Zacharias einwenden, tausend Abers lagen auf seiner Zunge. Aber sie kamen nicht raus. Kein einziges Aber kam über seine Lippen.
Draußen vor dem Tempel wunderten sie sich, wo Zacharias blieb. Als er schließlich herauskam, geschah etwas Merkwürdiges. Der Segen blieb ungesprochen. Als hätte es ihm die Sprache verschlagen. Zacharias schwieg und ging.
Er zog in einen Raum aus Stille. Neun Monate lang wohnte er darin. Neun lange Monate sprach er kein einziges Wort. Seine Stimme fing damit an. Sein Herz wurde ruhig. Die Zweifel verstummten. Irgendwann beruhigte sich auch der Zorn und sein wundgeglaubtes Herz erholte sich.
erzählt in der Wohnzimmerkirche
Superkraft

Am 21. November steht Kim an Omas Bett und denkt: „Das ist so typisch für Oma, dass sie kurz vorm Advent beschließt zu sterben.“ „Da seh ich schon die Lichter im Himmel“, lacht Oma, weil draußen jemand Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt hat. Trotz Energiesparen. Ein bisschen Licht muss sein, das findet auch Kim und strafft die Schultern. Jetzt bloß stark sein. „Ach stark“, sagt Oma, „immer diese olle Stärke. Wem willst du was beweisen? Guck mich an: Ich schaffe es nicht mal mehr, meine Kaffeetasse zu heben. Willst du etwa, dass ich so tue, als sei ich morgen wieder topfit? “ Kim schaut auf Omas dünne Handgelenke und die gläserne Haut und denkt: „Nee. Das wäre ja noch schwerer auszuhalten.“ „Siehste“, sagt Oma, weil ihre Superkraft schon immer Gedankenlesen war. „Kind“, sagt sie, obwohl Kim natürlich längst kein Kind mehr ist. „Ich sag dir eins: Wenn du glücklich sein willst, tu nicht immer so, als sei alles in Butter. Stärke ist eine Illusion. Such dir eine andere Superkraft.“ Dann lächelt sie ihr Omalächeln. „So, und nun sing mir was vor.“ Kim kann nichts singen außer „Alle Jahre wieder“. Das mussten sie in der vierten Klasse mal auswendig lernen. Bei „Geht auf allen Wegen // Mit uns ein und aus“ stirbt Oma, aber Kim singt tapfer weiter.
Samstag vorm ersten Advent wird Oma begraben. Im Ganzen, so hat sie das gewollt. Ein letztes Mal das Ausgehkleid tragen, mit Silberbrosche und dem geerbten Fuchsschwanz. „Wird ja auch wirklich Zeit, dass der endlich unter die Erde kommt“, hatte Oma gelacht. Vielleicht ist Humor auch eine Superkraft, denkt Kim und wirft einen Schokonikolaus ins offene Grab. Vollmilch natürlich. Bitteres gibt es ohnehin schon genug. Dann gehen alle zum Kaffeetrinken....
Die ganze Geschichte lesen:
Kann man auch hören: Deutschlandfunk, zum 1. Advent: hier zum Nachhören
Heilmittel

Thomas von Aquin, 13. Jh., handschriftlicher Zusatz (Echtheit noch unbestätigt)
Frühstücksei

Ich mag nur das Gelbe vom Ei. Am liebsten in diesem perfekt cremigen Zustand, nicht zu flüssig, aber auch nicht bröselig. Wenn ich ein Frühstücksei essen möchte, brauche ich also einen Mitesser. Oder eine Mitesserin, also eine Person, die lieber das Weiße mag. Das ist mir zwar unerklärlich, aber es gibt solche Menschen. Einmal traf ich einen kleinen Jungen, der war so einer. Wir wären ein perfektes Team gewesen, aber der Vater verbot es ihm. Er hatte seine Grundsätze: Der Junge müsse lernen, dass man sich nicht nur die Rosinen herauspicken dürfe.
Rosinenbrot schmeckt sehr gut mit Ei. Manche legen noch eine Scheibe Schinken darunter. Das würde ich nicht, aber sollen sie. Für mich reicht Butter. Vielleicht noch etwas Orangenmarmelade, Sanddorngelee ist auch fein. Was ich sagen will, ist: Es gibt sehr viele Möglichkeiten zu genießen. Man braucht keinen Glaubens-krieg daraus zu machen. Die Welt ist voller Köstlichkeiten, wir können sie einfach teilen. Frieden fängt beim Frühstücksei an.
Ministerin für transzendentale Sicherheit

Sehr geehrte Damen und Herren, du lieber Himmel,
wir müssen jetzt ganz stark sein: Sicherheit gibt es nicht. Das Konzept Welt ist in ständigem Wandel und niemand garantiert, dass das Spaß macht. Nicht mal, dass es instagrammabel ist. Soweit die schlechte Nachricht, jetzt die gute: Wir sind nicht allein. Verzeiht, wenn das wie Hohn klingt angesichts von Klimawandel-Leugnerinnen, Rechtsnationalen und größenwahnsinnigen Autokraten. Wir können uns darüber die Haare raufen oder ein Fort aus Decken bauen, wir können uns in unsere Höhlen verkriechen, netflixen oder – atmen.
Der Gedanke, dass acht Milliarden Menschen einmal am Tag nichts anderes tun als Atmen, wäre ein beruhigender Gedanke. Und Ruhe ist ein anderes Wort für Sicherheit. Damit meine ich nicht diese bedrohliche Ruhe vor dem Sturm, nicht die lähmende Ruhe, keine Kaninchen-vor-der-Schlange Ruhe und auch nicht diese Art von Ruhe, wenn in der SBahn alle auf ihr Handy starren. Ich denke an Ruhe, die verbindet: Hallo Gott. Ich bin hier. Du bist hier. Das reicht. Ich bin hier. Du bist hier. Das reicht. Auch wenn ich keinen Plan habe. Wenn ich mich im Gestrüpp eines zu vollen Alltags verliere. Wenn eine Flut von Scheißnachrichten runterzieht. Halten wir stand, ohne Held*innen zu sein. Eine halbe Stunde am Tag: Ich bin hier. Du bist hier. Das reicht. Listen and repeat.
Dreamer

Matze ist ein Klischee. Sein Schädel ist kahlgeschoren, sein Körper volltätowiert. Am Türrahmen hat er eine Strichliste für alle Nasen begonnen, die er schon gebrochen hat, aber irgendwann hat er den Überblick verloren. Bier ist sein Müsli. Nach einer kurzen, frühkindlichen Findungsphase hat er sich auf Hass spezialisiert.
Am 29. März spürt er, dass etwas mit ihm geschieht. Und allein das will schon was heißen. Spüren ist nicht Matzes Spezialgebiet. Irgendwas drängt ihn, an Katzenbabies zu denken, und erstaunlicherweise sind es keine Gedanken, die ertränken, erschlagen, anzünden beinhalten. Matze schüttelt sich. Schlägt mit der Pranke ein paar Mal ordentlich gegen seinen Schädel. Aber es geht nicht weg. Als nächstes ertappt er sich dabei, „Imagine“ zu summen. Er wusste nicht mal, dass das Lied in seinem passiven Erinnerungsschatz liegt. „Hä?“, grunzt Matze. „Was’n das für’n Geschwurbel?“ Die Melodie läuft unbeirrt weiter in seinem Kopf. Am Nachmittag schlichtet er Streit, kauft für Tanja ein Bund Margeriten, und als die Verkäuferin fragt, ob er einen Herzanhänger dazu möchte, nickt er beseelt. „Alter“, keucht er. „Ich muss krank sein!“ Zur Probe reißt er ein paar Autospiegel ab. Nichts. Kein Gefühl. Keine Befriedigung, im Gegenteil: Es drängt ihn, ein Entschuldigungsschreiben aufzusetzen. Einer tattrigen Oma hilft er über die Straße, und als sie die vielen bunten Bilder auf seiner Haut bewundert, sagt er artig „danke“. Den Rest gibt ihm eine humpelnde Taube, der er das Bein bandagiert. Matze K. kapituliert. Zum ersten Mal in seinem Leben. „You may say, I’m a Dreamer. But I’m not the only one…“
Opfer und Bauklötze und Wut

Es gibt
Leute, die explodieren regelmäßig. Wegen eines verspäteten Anschlusszugs oder der Sonntagsfahrer auf der Autobahn. Weil jemand keine Maske trägt, weil die Lasagne im Bistro auf sich warten lässt.
Weil die anderen anders leben wollen und keine Ahnung haben. Zugbegleiter werden angeschrien, Polizistinnen, Mitarbeiter in sozialen Einrichtungen, Politikerinnen. Vom Internet erst gar nicht zu
reden. „Das musste mal raus“, scheint ein ausreichender Grund zu sein. Aber eine Gesellschaft ist kein Kindergarten. Da kann nicht einfach jeder losschreien, wenn ihm was nicht passt. Und selbst
im Kindergarten lernt man: du sollst deinen Nächsten nicht mit Bauklötzen bewerfen.
Was das mit Kain und Abel zu tun hat und warum ich nicht glaube, dass Gott Opfer braucht: Deutschlandradio Kultur
Wer bist du?

Ich bin seit 49 Jahren Mensch. Im Körper einer Frau. Manchmal fällt mir das auf, aber eigentlich ist es so selbstverständlich, wie eine Nase zu haben. Ich kann gut zuhören, aber nicht nähen. Ich mache gern Feuer, finde Röcke angenehmer als Hosen und mochte rosa schon, bevor es Prinzessin Lillifee trug. Ich habe keine Kinder geboren und bin glücklich damit. Ich fahre gern Auto, genieße es manchmal, mich anzulehnen und übernehme an anderen Tagen die Führung. Ich hasse es, mein Fahrrad zu flicken und freue mich, wenn jemand Spinnen aus dem Weg räumt. Eine Maus würde ich aber jederzeit auf die Hand nehmen. Manchmal bin ich härter als ich will. Ich koche täglich, eine Bratpfanne auf dem Geburtstagstisch wäre für mich keine Beleidigung. Fußballübertragungen langweilen mich, Fashionfragen auch. Ich habe eine Vulva und finde das gut, allerdings habe ich auch keinen Vergleich, wie es mit einem Penis wäre (etwas unpraktischer stelle ich es mir vor). Die Frage, ob ich mich weiblich fühle, spielt für meine Identität keine große Rolle. Ich bin ich. Ich fühle mich gut (jedenfalls im Großen und Ganzen). Und ich möchte in einer Welt leben, in der das jede und jeder von sich sagen kann. In der Menschen dieselben Rechte haben. Einen Rock tragen dürfen und einen Bart. An manchen Tagen zartbesaitet sind, an anderen gestählt. Alle Zeit der Welt mit Kindern verbringen dürfen, ohne sich zu erklären; mit einem Floß den Mississippi queren oder glücklich hinter Aktenordnern verschwinden. Mit Hüftschwung durch die Straßen gehen oder mit Stiernacken. Und das alles sollte keine Frage des Geschlechts sein, sondern der Sehnsucht: Wer bist du? Was entspricht dir? Ich möchte in einer Welt leben, in der es weniger Kategorien gibt und mehr Sein.
Geröll und Topfenstrudel

Ich bin auf einen Berg gestiegen, habe den Kühen gesagt, sie mögen auf ihrer Seite bleiben, bin über 100000 Kilo Geröll geschlittert, und am Ende bin ich in den See gesprungen und habe einen Saibling getroffen.
Die Freiheit war auch unterwegs, sie lief immer einen Schritt voraus. Manchmal saßen wir zusammen auf eine Stein. Ihre Nachbarin ist das Glück und eine Gams, beide sind etwas scheu.
Ich habe ein Käsebrötchen gegessen und keinen Topfenstudel. Obwohl er sich angeboten hat, aber das war mir zu aufdringlich. Die weiteren Aussichten sind unbestimmt. Das Handy sagt, ich solle es in den See werfen. Das sei auch Freiheit.
#schreibreise #kalkalpen
Pfingstbeflügelung

Ich glaube an Vorfreude
auf Honigbrot und Höhenflüge
weil im Moment davor alles möglich ist.
Ich glaube an Vergebung
Ich glaube, dass auch im Moment danach
Nichts unmöglich ist.
Ich glaube, dass Gott eine Zauberin ist.
Ich glaube an Schmetterlinge
Ich glaube an alle
die gerade Raupen sind
Halber Himmel

Morgens stehe ich aus dem Bett auf. Mittags vom Tisch. Aber vom Tod? Keine Ahnung. Ich glaube es versuchsweise, und wenn es dann nicht klappt, wenn dann alles schwarz und Schlaf ist, dann merke ich es ja nicht mehr. Bis dahin lebe ich. Esse Zimt-schnecken, halte meine Nase in die Sonne, stell mich in den Kirschblütenregen, streite (aber schmolle nicht) und feiere das Leben, so oft ich kann. Muss alles immer erfüllt sein? Ist es sowieso nicht, jedenfalls nicht in meinem Leben. Mir reicht ein halber Apfelkuchen, ich brauche keinen ganzen. Wer immer auf Erfüllung wartet, könnte am Ende mit leeren Händen dastehen. Ich möchte mich erinnern an ein paar spontane Ausflüge ans Meer, an das Lachen meiner kleinen Nachbarin, an Bring-was-du-hast-Abende, an Küsse im Nieselregen, an das ein oder andere gelesene Buch, an den Geruch von Waldmeister im Mai. Ich möchte mich daran erinnern, dass ich schon jetzt mehr Erinnerungen habe, als ich mir träumen ließe. Rette mich, Gott, vor der Vorstellung, dass immer noch was Größeres kommen muss. Der Himmel beginnt hier, mit einem halben Fuß steh ich schon drin.
Weniger ist Meer

Vielen Dank
für 20 rechte Hände
und das Rascheln der Bleistifte auf dem Papier
Vielen Dank für die Möwe,
die mein Eis verschont hat
Vielen Dank für das Glück,
frei zu sein und einfach auf eine Insel fahren zu können
Vielen Dank für Sanddorngelee
einen Platz im Strandkorb
und einen Morgen aus Gold
Vielen Dank für Dinge
die schon immer mal gesagt werden wollten - Brathering, Himmelsexpeditionen und die Geschichte eines Föns
Vielen Dank für das Meer
nicht weniger als das.
Eine Woche Schreibworkshop auf Langeoog.
Tschüss, bis nächstes Jahr!
Ich wünschte

Statusmeldung
Im Fernsehen weint ein Mann.
Er hat dieselben Leichen gesehen wie ich - aber in echt.
Ich schalte den Fernseher aus und koche Griesbrei.
Mit Omas Messer schneide ich einen Apfel.
Ich weine, dass die Welt nicht klüger wird.
Ich weine vor Entsetzen und rieche Vanille.
Von hier

Was ich von hier aus sehe
Rosa Blüten, die sich nicht einschüchtern lassen.
Sanftmut ist auch eine Stärke.
Ich trainiere täglich eine halbe Stunde:
Widersprechen in Fis-Dur.
Mit einem Rhinozeros auf Zehenspitzen tanzen.
Einen Streit als Stummfilm führen.
Zuversicht verstreuen. Mich besonnen.
Offener Brief an Gott

Wenn es dich gibt, warum greifst du nicht ein? Nein - halt, warte, das soll gar keine Frage sein, weil jetzt nicht die Zeit für philosophische Gedankenspiele ist. Wenn es dich gibt, dann tu was. Fall Herrn Putin in den Arm und seinen Mitstreitern auch. Du kannst einwenden, dass meine Bitte spät kommt, Kriege gibt es auf der Welt, solange ich lebe. Du hast recht. Aber ich bin - im Gegensatz zu dir - ein Mensch. Je näher das Unfassbare kommt, desto fassungsloser macht es mich. Ich habe kluge Bücher gelesen und mir Antworten zurechtgelegt, warum du das tust: Nichts tun. Dass du nicht kannst, ist so ein verstörender Gedanke. wenn nicht mal du - wie dann wir? Ich wage nicht, um Trost zu bitten, weil andere den viel dringender brauchen. Jede Bitte kommt mir falsch vor, weil hinter allen Bitten die eigentliche steht: Mach dem Töten ein Ende.
Ich fühle, dass es dich gibt. Ist das alles?, frage
Ich (gerade auf Flügeln der Morgenröte unterwegs)
Ungeduld

Als erstes wird der Frühling kommen. Und er kommt, soviel ist immerhin sicher. Und es wird Tage wie diesen geben, an denen die Sonne scheint, und der Himmel ist klar, und ich werde mich hinausträumen in den Wald, der hellgrün trägt und süß riecht. Und für einen Moment wird mich das beruhigen. Und dann wird mir das Lied von den Mandelzweigen in den Sinn kommen, das ich mich eigentlich schäme zu singen, weil es so eine naive Gott-macht-alles-gut-Haltung dahinträllert, aber plötzlich ist es erwachsen geworden und beharrt darauf, dass Waffen schweigen werden, die Lieder aber nicht. Und dass im Übrigen nicht ich Richterin zu sein brauche, der Job ist zu groß für mich, schon gar nicht Weltenrichterin. Die Stelle sei auch schon vergeben, sie säße wachsam auf ihrem Platz, ihre Engel leisteten Erste Hilfe, manchmal gelänge es ihnen auch einzugreifen, aber was solle man schon tun gegen abertausend Soldaten. Wo ist das Licht, frage ich, wenn Menschen sterben? Wie soll man da überhaupt ein Lied singen, wie soll man da glauben an die Vernunft, an die Liebe, an eine Zukunft, die gemeinsam stattfindet? Die Weltenrichterin wird weise ihre Antwort wägen, sie rechne in Jahrtausenden - und entschuldigt sich dafür, sie wisse, sie verstehe mittlerweile, was Ungeduld heiße, deshalb schicke sie Sonnentage und Frühling und Lieder und Engel, und alles, was sie habe.
Ohne Titel

’s ist Krieg! ’s ist Krieg! O Gottes Engel wehre,
Und rede Du darein!
’s ist leider Krieg – und ich begehre,
Nicht schuld daran zu sein!
Matthias Claudius, 1778
Ich will mich verkriechen. Russland hat die Ukraine angegriffen. Es ist Krieg. Dagegen wirkt Corona blass. Ich muss mich zwingen zu arbeiten (weil mir nichts besseres einfällt). Wann wird es wieder gut sein? Wann wird man rausgehen können und die wichtigste Nachricht des Tages ist eine neue Bucherscheinung oder die Ankunft der Zugvögel?
Gestern saß ich in der Kirche und sah, wie ein Sonnenstrahl den Flügel eines Engels streifte, während in den Nachrichten Bomben fielen. Der Engel hielt einen Siegeskranz in den Händen, Frieden ruft er, und ich halte mich fest an der Hoffnung, dieser Engel sei längst unterwegs.
Staub und grüner Klee

Glaubst du an Gott? Und wenn ja: Glauben du, dass Gott etwas Bestimmtes mit dir vorhat? Dass da ein eingespeicherter Plan ist, der deinem Dasein einen Sinn gibt?
Ich glaube an Gott. An einen Plan glaube ich nicht. Obwohl mir der Gedanke gefallen würde: Mit einer Mission unterwegs zu sein. Bei der jede vertrödelte halbe Stunde an der Bushaltestelle, jede schlaflose Nacht einen Sinn bekäme. Eine Mission, die bestimmte Fragen ein für alle Mal klärt: Wofür ich aufstehen soll. Ob Abwasch oder Twitter gerade wichtiger ist. Welche Freizeitbeschäftigung mich erfüllt. Eine Mission, der ich zielgerichtet durch den Alltag folge. Eine Mission, die aus mir eine Superheldin macht.
Aber Gott schüttelt den Kopf: „Nope. Keine Mission für dich. Die schlechte Nachricht ist: Ich brauche dich nicht.“ Das muss erstmal sacken. In der Sache überrascht mich das nicht wirklich, aber etwas mehr Behutsamkeit hätte ich von Gott schon erwartet. Zwar bilde ich mir nicht ein, unersetzlich zu sein. Schon gar nicht weltweit betrachtet. Aber es wäre schön zu wissen: Susanne, die ist dafür da, dass 17,3 % ihres Umfeldes weniger streiten. Noch besser wäre natürlich etwas Größeres. Susanne soll eine Pyramide bauen. Zum Beispiel. Etwas Konkretes, an dem man arbeiten kann im Leben. Zeichnungen anfertigen, Räume ausmessen, Steine hauen, Mittagspause machen und ein Käsebrot essen. Start and Repeat. „Die Welt braucht keine Pyramiden mehr“, holt mich Gott zurück. Ich frage: „Was dann?“
Gott räuspert sich: „Ich zitiere: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was ich von dir will: Gerechtigkeit tun, Freundlichkeit lieben, und demütig mitgehen mit deinem Gott. Die Bibel, Buch Micha, Kapitel 6.“
Ich zucke zusammen. Demut. Wirklich? Das verstaubteste aller Mutworte?
Was die gute Nachricht ist und warum Demut ein Mutwort ist, das nur auf den ersten Blick schüchtern wirkt, erzähle ich hier:
Weiterlesen oder hören: Deutschlandfunk Kultur
Neulich auf dem Weg zum Bahnhof

Jesus treibt sich auch wieder in den schummrigsten Ecken rum...
Lichtmess

Der Morgen leuchtet heller als der letzte Stern in meinem Fenster.
Zwischen Inzidenzen wachsen Krokusse. In die Nachrichten mischt sich das Lied einer Amsel. Ich packe mein Weihnachts-Ich in Holzwolle, falte die Decke zusammen und verlasse die Enge des Stalls. Irgendwas kommt mir entgegen. Ich weiß noch nicht was, aber es wird sich lichten. Täglich 3,41 Minuten mehr.
Frohe Weihnachten!

Dass Weihnachten ein Fest für Naive sei, lese ich, weil niemand die Welt retten kann. Schon gar nicht ein Kind, auch in 2000 Jahren nicht. Dann will ich naiv sein. Wenigstens einmal im Jahr will ich meiner Kinderseele recht geben, die darauf besteht, dass Herbergen sich öffnen. Die glaubt, dass es solche Nächte gibt, in denen Rosen blühen und das Eis schmilzt. Wenigstens einmal im Jahr sollen die Herzen weich werden und durchlässig, damit wir nicht verlernen, wie das geht. Soll die Sehnsucht Raum finden, damit wir nicht verrohen. Mag sein, dass das die Welt nicht ändert. Aber uns.
Lieber Sonntag,

jede Woche freue ich mich auf deinen Besuch. Du bringst Brötchen mit oder Kuchen, und immer nimmst du dir einen ganzen Tag Zeit. Früher konnte ich nicht so viel mit dir anfangen. Da hielt ich dich für etwas verschroben. Jetzt mag ich das. Dass du so anders bist. Mit dir kann man Pläne schmieden, auf dem Sofa lümmeln, in dicken Büchern versinken, die Zukunft rosa färben, eine geheime Sprache erfinden, mit dir kann man den Himmel stürmen. Du bist zwecklos, und das entspannt mich. Du willst nichts von mir. Du stellst Fragen, für die ich sonst nie Zeit habe: Wofür ich lebe. Was mich glücklich macht. Was ich der Welt geben will. Ob Himbeeren was mit Himmel zu tun haben. Ich mag auch deine Fürsorge. Du hast ein Auge auf mich. Siehst, wenn ich müde bin, und dann machen wir einen Mittagsschlaf. Wenn ich Wind um die Nase brauche, ziehst du mich raus. Manchmal redest du mir ins Gewissen: "Mach mal was, das du nicht musst. Heute gehörst du mir - und ich gebe dir frei." Das ist deine Art der Liebeserklärung. Du bist ein Schatz!
Unser Kalender für 52 unverbrauchte Sonntage ist fertig: Luft nach oben 2022! Den Kalender könnt Ihr hier bestellen.
Advent

An einem Herbstmorgen
hol die rote Mütze raus
nimm die Einsamkeit von der Stirn
schreib einen Brief auf Zeitungspapier
bau deinen Himmel aus Atemwolken
der Engel ist Zigaretten holen
warte nicht
Nocheinmal!

Für alle halb gelebten Leben
und für alle himmelhohen Träume.
Für alle missglückten Anfänge
und für das Glück, das noch aussteht.
Für alle Liebe, die auf der Strecke blieb
und trotzdem nicht verloren ist.
Für alle kühnen Versprechen und auch für die Halbherzigkeit.
Für alles Scheitern, für alles Nocheinmal.
Für das, was offen ist.
Für die angebrannten Kekse und das halbvolle Glas.
Für das Hoffen und das Sehnen.
Für viel zu große Schuhe und klitzekleine Schritte.
Für die Lust, für die Leichtigkeit.
Für uns, Held*innen und Hasenfüße.
Wohnzimmerkirche

Warum ich Wohnzimmerkirche so mag:
weil der Raum offen ist und das Licht weich. Vieles ist in der Schwebe. Vielleicht auch Gott. Niemand hat den Gral. Oder alle. Weil Jan so wunderschön unspektakulär singt. Ohne Wehr und Waffen. Weil Gedanken im Reden entstehen. Miteinander reden. Liebe schmeckt nach Cider und macht nicht viel Aufheben. Ist einfach da. Und weil manchmal schon eine bunte Lichterkette und ein paar Gleichgesinnte genug sind.
Andererseits

Einerseits ist nun leider November. Andererseits leuchten die Ahornbäume nie schöner als jetzt. Auf meiner Liste rangeln die To-dos um den ersten Platz. Andererseits ist morgen sowieso Wochenende. Meine Friseurin sagt, keiner hat mehr Lust auf Corona. Ich auch nicht. Also muss ich lernen, für meinen Lockdown selbst zu sorgen, wenn alles zu eng wird. Ein Freund ist begraben. Die Motten im Keller lassen sich nicht unterkriegen. Ich wünschte, es wäre andersherum. Das Leben richtet sich nicht nach meinem Wunschzettel, jedenfalls nicht zuverlässig. Ich schreibe trotzdem einen, mindestens in Gedanken. Wünsche halten das Herz warm. Drinnen riecht es nach Heizungsluft, andererseits habe ich endlich wieder eine Heizung und keinen Nachtspeicher mehr. Letzte Woche hat sich im Traum der Himmel geöffnet. Wunschdenken sagen die einen. Trotzdem bleibt ein Leuchten zurück.
Drinnen

Vergesst nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt.
Die Bibel, 1. Korinther 6, 19-20
Auf der Suche nach Gott tritt sie in die Kirche. Die Tür ist offen. Drinnen brennen Kerzen und es riecht nach Nelken, die jemand auf den Altar gestellt hat. Sie setzt sich. Lange war sie nicht mehr hier. Doch schon bald tut ihr auf der harten Bank der Rücken weh. „Das musst du aushalten“, ermahnt sie sich, aber vor lauter Aushalten vergisst sie, wonach sie sucht, und nach einer halben Stunde geht sie unverrichteter Dinge nach Hause.
Gott hat sie sich immer erhaben vorgestellt. Einer, der in einem Haus wohnte, dessen Säulen in den Himmel ragen, muss einfach erhaben sein. Gold ist sein Kleid. Ihre Kleider dagegen hängen wie Säcke an ihrem unförmigen Körper. Das hat ihre Mutter mal gesagt, und sie hat es nie vergessen. Obwohl es schon Jahrzehnte zurückliegt. Heute sieht sie auf Instagram Pastellfotos lichtgefluteter Frauen, deren feingliedrige Hände einen Becher Kräutertee mit dem schönen Namen „Seelenzauber“ umfassen. Manchmal lächeln sie auch aus einer komplizierten Yoga-Pose entspannt in die Kamera. Dazu posten sie das Hashtag #Selbstliebe, als sei es das Normalste von der Welt. Ihr ist das fremd. Sie würde wetten, dass ihre Mutter das Wort nicht mal kennt. „Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach…“, murmelte sie Woche für Woche. Die Hände gefaltet, den Kopf gesenkt. Selbstliebe klingt verdächtig nach Eitelkeit, denkt sie. Eine der Hauptsünden, hat sie gelernt. Die von Gott ablenken.
In dieser Nacht träumt sie, dass sie mit Gott verstecken spielt. Auf einmal ist sie wieder Kind in ihrem rotgepunkteten Lieblingsrock. „Mäuschen, sag mal Piep!“, ruft sie, und Gott ruft „Piep!“ Aber sie kann Gott nirgends finden, nicht hinterm Sofa, nicht unterm Bett, nicht im Schrank. „Näher“, flüstert Gott, „viel näher“, und die Stimme scheint eindeutig aus ihrem Bauch zu kommen.
Was man für einen Unsinn zusammenträumt, denkt sie beim Aufwachen. Trotzdem cremt sie sich an diesem Morgen besonders sorgfältig ein. Sie lässt keinen Zentimeter und keine Delle ihres Körpers aus, der plötzlich so viel mehr sein könnte, als eine unvollkommene Hülle für Herz, Niere, Lunge und ein paar Meter Blutgefäße.
Sternchen

Das ZDF gendert Islamist*innen. Viele finden das blöd. Ich finde es gut. Solange man kein Dogma daraus macht. Nicht bei jedem vergessenen „innen“ eine Grundsatzdiskussion beginnt, nicht wegen eines kleinen Sternchen den Weltuntergang wittert. Meine Aufgabe ist es, kreativ damit umzugehen. Eine Sprache zu finden, die schön und präzise ist und den Horizont weitet. Das ist manchmal tricky, aber das ist es auch ohne Gendersternchen. Ich sehe es als Herausforderung. Und ich mag Herausforderungen. Als ich „Islamist*innen“ las, habe ich mich natürlich sofort gefragt, wieviel weibliche es wohl gibt. Und wie viele, die sich keinem Geschlecht oder beiden zuordnen. Letztere tendieren wahrscheinlich gegen Null. Zumindest jene, die sich das eingestehen. Dabei könnte es sie trotzdem geben. Das Sternchen macht die Welt und mein Denken mehrdimensionaler.
Ich schreibe selten über Islamist*innen und mehr über Gott. Dass Gott kein Er ist und keine Sie, ist sowieso klar. Trotzdem wird oft so gesprochen, als sei Gott ein mittelalter Mann mit Hut. Wieso reden wir immer noch so? Herr, Vater, Schöpfer, Er. Ich weiß: Grammatikalisch ist das eine Herausforderung, weil Gott im Deutschen genauso männlich ist wie der Baum und der Apfel. Ich habe mein halbes christliches Leben damit verbracht, zu übersetzen. Mitgemeint zu sein, wenn von Brüdern die Rede ist oder von Christen. Neben die Metapher des Vaters die Mutter gesetzt (und immer gedacht: Ziemlich doof, wenn jemand mit einem oder beiden Elternteilen nichts Gutes verbindet. Was ja nicht so selten ist.). Meine Vorstellung von Gott ist integrativ. Jeden und jede zu sehen, weiter, offener, liebender als ich das kann.
Schäm dich. Nicht.

Als Adam und Eva einander kennenlernten, war alles unkompliziert. Hatte Adam einen Bauchansatz? Waren Evas Beine rasiert, lag ihr Bodymassindex im grünen Bereich? War Adam ein echter Mann, war Eva eine richtige Frau? Wir wissen es nicht. Alles, was berichtet wird, ist: Sie waren nackt und schämten sich nicht. Offenbar gab es nichts zu verheimlichen und nichts zu retuschieren. Sie waren, wie sie waren, und das war gut.
Anfang zwanzig wurde ich zum ersten Mal mit den Haaren auf meinem Körper konfrontiert und der Ansage, dass sie da nichts zu suchen haben. Bislang hatte ich sie zur Kenntnis genommen wie meine Ohrläppchen und meinen linken kleinen Zeh. Sie waren eben da, benötigten aber keine besondere Aufmerksamkeit. Auf einmal wurden sie peinlich. Ich lernte, mich zu rasieren und mich zu schämen, wenn ich es vergaß. Heute gibt es in sozialen Netzwerken ernsthafte Diskussionen darüber, wie schlimm es ist, wenn Frau (zuweilen auch Mann) Körperhaar zeigt. Und nicht nur darüber – auch über die Lücke zwischen den Oberschenkeln und die Optik der Schamlippen kursieren Schönheitsvorgaben. Bodyshaming nennt man die Ansage, wenn nicht alles passt.
Scham ist ein fieses Gefühl. Es suggeriert: Du bist nicht richtig. Du gehörst nicht dazu. Wie kannst du es wagen, dich so zu zeigen? Körperbehaarung ist da noch ein vergleichsweise kleines Problem. Man kann sich schämen, arm zu sein, die Verhaltenscodes für eine bestimmte Gruppe nicht zu kennen, keine Kinder oder zu viele Kinder zu haben, den falschen Beruf auszuüben und „nur“ Putzkraft zu sein. Menschen schämen sich, gemobbt oder missbraucht worden zu sein. Man kann sich schämen, da zu sein...
Scham ist ein ambivalentes Gefühl. Zu viel davon tut nicht gut – es macht uns kleiner, als wir sind. Zu wenig davon tut auch nicht gut – es macht uns größer, als wir sind. Scham ist die innere Stimme, die sagt: Du bist nicht Gott. Brauchst du auch nicht zu sein.
(...)
„Der liebe Gott sieht alles“, habe ich irgendwann gehört. In einem Kinderlied aus den 1970ern heißt es: „Pass auf, kleines Auge, was du siehst! Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst! Pass auf, kleine Hand, was du tust! Pass auf, kleines Herz, was du glaubst! Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich…“
Gott als großer Stalker. Als verlängerter Arm irdischer Moral: Gott sieht, wenn du auf Mama und Papa wütend bist. Wenn du Kekse aus der Dose klaust. Gott sieht, wenn du heimlich rauchst, wenn du masturbierst, wenn du davon träumst, deinen Schwarm aus der Nachbarklasse zu küssen. Gott sieht all deine Gedanken. Über allem schwebt das Damoklesschwert der Scham. Denn wie wahrscheinlich ist es, einen solchen Gott zufriedenzustellen?
Ich glaube nicht, dass Gott ein Aufpasser ist. Ich glaube auch nicht, dass Gottes Blick beschämt. Er richtet auf.
Adam und Eva haben viele Nachkommen. Sie sind Allerweltsmenschen und tragen unsere Namen. Adam ist ein Angsthase. Eva will endlich aufhören, ihre Körperhaare zu entfernen. Simon wohnt im Nachbarhaus und liebt Joschua. Werner singt im Kirchenchor und träumt manchmal von Sachen, die er keinem erzählen würde. Elisabeth träumt mit 79 immer noch von Sex – und schläft mit einem jüngeren Mann. Klaus weint, wenn er den Soldaten James Ryan sieht und wenn er im Stadion die Nationalhymne singt. Esther kocht für sieben Enkel und weigert sich, zur Sportgruppe zu gehen. Ben pflückt Blumen und spielt gern Paintball. Janne baut lieber ein Bücherregal anstatt zu bügeln. Michael träumt davon, Michaela zu heißen. Christiane ist es manchmal unangenehm, einfach nur Mutter zu sein und liebt es trotzdem. Kemal will der Stärkste sein und dennoch zärtlich. Laya wird Physikerin und kauft Kuchen eingeschweißt im Supermarkt. Oliver neigt zur Hochstapelei und besitzt gleichzeitig eine gute Portion Selbstironie. Maren liebt Tom und liebt Yasmin.
Und für nichts davon, aber auch für gar nichts davon brauchen sie sich zu schämen.
Weil ein wohlwollender, zutiefst freundlicher Blick auf ihnen ruht, der sagt: Du bist richtig. Dieser Blick gilt jedem Menschen, und wer das vergisst, kann sich erinnern, wenn das Gefühl, falsch zu sein, groß ist: Du bist sehr gut.
Ganzen Artikel lesen oder hören: Am Sonntagmorgen. Deutschlandfunk
Saumselig

Heute war ein guter Tag. Ich habe keine Wand gestrichen, auch habe ich den Kühlschrank nicht abgetaut. Ich habe kein Problem gelöst, nicht ein einziges. Aber auch keines schlimmer gemacht. Das Gras ist ungemäht geblieben. Die Zeitung liegt ungelesen auf dem Küchentisch. Ich habe mich nicht angestrengt, mein Geld habe ich nicht vermehrt (ich wüsste auch nicht, wie). Ich bin mit niemandem in Streit geraten, habe nichts besser gewusst, und auch die Zeit habe ich nicht versucht, anzuhalten.
Saumselig bin ich durch den Tag gegangen. Das ist ein Wort, das auf der Zunge zergeht. Versäumen steckt darin. Manchmal muss man was ausfallen lassen, damit das Glück einen antrifft. Meine Seele ist sehr glücklich darüber, abkömmlich zu sein. Sie ist unterwegs in anderen Sphären, ist Zitronenfaltern hinterher-geflogen und hat Himbeeren gepflückt. Gegen Mittag habe ich sie im Gras liegen sehen, ihre Träume waren blau. Abends hatte sie dann so ein Lächeln im Gesicht, als wüsste sie etwas, das ich noch
nicht weiß. Eine Ahnung von mir, wie ich bin, wenn ich nicht muss.
Kann man auch hören: NDR-Moment Mal
Zugreifen

Der Dienstag vor 2000 Jahren begann nicht gut. Der Himmel ist bewölkt. Die Brotpreise steigen. Es gibt Hassbotschaften, selbst aus unserem Netz. Wir brauchen eine Pause, das ist offensichtlich. Also brechen wir auf und verschwinden. Denn das habe ich gelernt in dieser Zeit: dass man es nicht allen recht machen kann.
Aber wir bleiben nicht allein. Andere kommen dazu. Leute, die wir noch nie gesehen haben. Wir setzen uns ins Gras. Es liegt was in der Luft: Etwas Unvollendetes, eine Sehnsucht, die sich heute Abend erfüllen könnte. Ich bin das Licht, sagt Jesus, und die Leute halten ihre Gesichter in die Sonne. Ich bin das Brot, sagt er. Ich schließe die Augen und lasse die Worte auf der Zunge zergehen.
Es ist spät, flüstert Petrus. Die Leute haben Hunger. Und dass wir jetzt mal was organisieren müssten. Ich schließe meine Augen wieder. Ich will nichts organisieren.
Am Horizont erscheint der erste Stern. Schickt sie nicht weg, sagt Jesus. Es ist so schön. Gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben fünf Brote, zwei Fische und einen angebissenen Apfel. Jesus sieht zum Himmel und dankt dafür. Ich kenne niemanden sonst, der für einen angebissenen Apfel dankt. Für das Wenige, das Halbe, das Unvorbereitete. Das, was jetzt da ist. Mein Herz klopft, als er uns das Brot gibt. Nehmt, sagt er. Gebt. Wir reichen weiter, was wir haben. Ohne abzuzählen. Ohne uns zu versichern, dass es genug ist. Wir machen einfach. Die Mutigen greifen zu. Schmecken. Kosten den Moment und genießen. Keiner beschwert sich, dass es zu wenig ist. Niemand drängelt. Alle machen mit. Die Angst, es könnte nicht reichen, verschwindet. Über die Wiese wehen Worte und Lachen, jemand holt eine Mundharmonika raus. Es ist längst dunkel geworden, aber niemand will gehen. Ist das ein Wunder?
Neustart
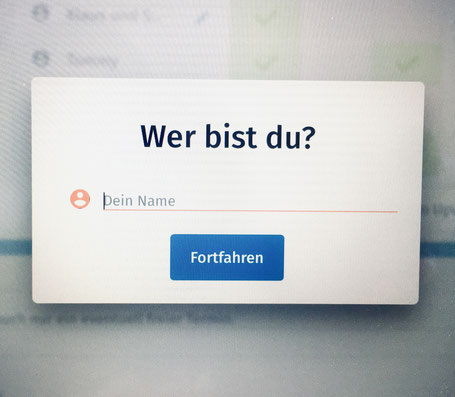
Als um 12 Uhr 17 die Welt neugestartet wird, hat Heiner mal wieder nichts mitbekommen. Dabei haben sie es auf allen Sendern gebracht: Dass man alle Anwendungen schließen solle. Was nicht gespeichert ist, ginge verloren. Vorsorgliche Menschen haben Sicherungskopien ihren Lebens gemacht, um genau dort wieder beginnen zu können, wo sie aufgehört hatten. Heiner natürlich nicht. Er hätte nicht mal gewusst, wie das geht.
Plötzlich ist alles so aufgeräumt. Nirgends hakt es mehr. Kein Update wartet. Stattdessen liegt etwas Neues in der Luft. Während die einen panisch versuchen, einen Techniker zu bekommen, der ihr altes Leben wiederherstellt, feiern die anderen, dass die Schulden gelöscht, Viren verschwunden und auch der Streit mit Isabelle aus der Welt ist. Heiner kratzt sich am Kopf, und dann öffnet er ein neues Fenster. Die Zukunft wird sich zeigen.
Pfingsten reloaded

In jenen Tagen geschah es, dass sie hinter verschlossenen Türen saßen und ihre Gesichter grau geworden waren und ihre Worte drehten sich im Kreis. Gremien wurden berufen und Ausschüsse gebildet und Antworten wurden an Fachleute delegiert und der Kleinmut hatte sich breitgemacht. Da wundert sich Gott: „Welche Fachleute denn? Die Fachleute, das seid doch ihr. Habe ich denn einige höhergestellt als andere? Habe ich meine Worte exklusiv verteilt? Ich habe sie in euren Mund gelegt und die Begeisterung in euer Herz.“ „Aber wir“, sagen sie, „wir wissen doch auch nicht. Einer glaubt so, die andere so. Wir sind so verschieden, wir können uns nicht einigen. Wir haben siebenundneunzig Punkte auf der Tagesordnung, und wenn wir fertig sind, dann fangen wir wieder von vorn an, weil niemand uns versteht!“ Da öffnet Gott die Türen und reißt die Fenster auf, dass Wind in die Sache kommt und die Angst fortpustet und Friederike fühlt sich plötzlich beschwingt wie nach einer halben Flasche Champagner. Der Herr Bischof spürt ein Beben in seinem Herzen und ist so erleichtert, weil er mit seiner Liebe nicht mehr hinterm Berg halten muss. Egon Hinterwald wundert sich, dass man alles auch ganz anders sehen kann, als er es tut, aber noch mehr wundert ihn, dass ihn das gar nicht mehr ängstigt. Hilde aus dem Frauenkreis lernt von Janne, was „queer“ bedeutet und beide spüren eine Weite im Kopf, als hätten sie nach Jahren den Dachboden entrümpelt. Worte wie Sehnsucht, Großmut, Gnade leuchten auf. Nichts davon lässt sich in Stein meißeln. Zwischen den alten Mauern wird es eng. Gott ruft: „Wer hat gesagt, dass Ihr Mauern braucht?“ Ein Hauch genügt, sie zum Einsturz zu bringen und Himmel breitet sich aus, schillernd und schön. Gemeinsam treten sie ins Freie, Friederike und der Herr Bischof, Hilde und Egon. Petrus und Phoebe sind dabei, Johanna und Jakobus. Herr Windli bringt seine Maria mit und Janne schwenkt eine Regenbogenflagge. Mireile singt ein gregorianisches Lied, nebenan setzen Technoklänge ein – und es ergänzt sich erstaunlich gut. Dazwischen schwebt Gott, überall zugleich. Alle haben sie gesehen, haben ihn gehört, haben es gespürt. Tausend Geschichten werden zu einer. Niemand will Recht haben. Macht ist ein vergessenes Wort, denn alle verstehen, was stark macht: Miteinander reden, voneinander lernen, aufeinander hören. Eine macht den anderen groß. Niemand will der Größte sein.
Und alle Welt beginnt zu staunen über jene, die leicht wirken und deren Worte nicht erschlagen, sondern prickeln wie Champagner oder weiße Johannisbeerschorle.
Als ich mit Jesus auf dem Balkon sitze

»Ich bin glücklich.«
Die Sonne ist gerade hinter den Häusern verschwunden. Du hast die Füße auf die Brüstung gelegt und balancierst auf deinem Bein ein Bitter Lemon.
»Überrascht dich das?«, fragst du.
»Ich weiß nicht. Glück ist so ein großes Wort. Muss man sich das nicht für die wirklich großen Momente aufsparen?«
Du lachst. »Hast du Angst, dass es sich abnutzt?«
Was weißt du schon vom Glück, frage ich mich stumm, um dich nicht zu verletzten. Du hörst es trotzdem.
»Du denkst, ich habe mein Glück geopfert. Für etwas Größeres. Aber so ist es nicht. Jetzt zum Beispiel möchte ich nichts lieber tun, als hier mit dir zu sitzen.«
Ich bin ein bisschen verlegen, weil ich mich freue.
»Ich kaufe Brot«, fährst du fort. »Ich helfe einem Gelähmten auf die Beine.
Wenn es einen Dämon zu vertreiben gibt, vertreibe ich ihn. Ich bete.
Ich wasche meine Füße. Ich kämpfe für so etwas Großes wie Gerechtigkeit.
Aber ich denke nicht darüber nach, ob ich lieber etwas anderes täte.
Oder woanders sein wollte.«
»Wirklich nie?«
Du schüttelst langsam den Kopf.
Deshalb also fühle ich mich so wohl bei dir.
aus: Schau hin. Vom Hellersehen und Entdecken
Nach einem Zoom-intensiven Wochenende

Gott zoomt jetzt oft. Wo er sich seltener unter die Leute mischen kann. Früher saß er freitags oft in der Kneipe neben Monika, und wenn es spät wurde, dann hakte er den Hans unter und passte auf, dass er nicht über einen Bordstein stolperte. Aber die Kneipen haben zu. Hans sitzt viel zu oft allein in seinem Zimmer. "Treffen wir uns auf Zoom", sagt Gott, aber Hans macht eine verächtliche Handbewegung. "So'n Schnickschnack mach ich nicht mit." "Bitte", sagt Gott, "wo du doch das neue Handy hast." Aber Hans will nicht. Gott lässt nicht locker.
"Weiß nicht, wie das geht", murmelt Hans schließlich.
"Musste ich auch lernen", sagt Gott, "ist nicht schwer."
Da wird Hans hellhörig. "Du? Wenn einer nix lernen muss, dann doch wohl du!"
"Hans, wie kommst du denn auf sowas." Und dann sagt Gott einen seiner Sätze: "Ich werde sein, der ich sein werde." Und weil Hans guckt, wie er guckt, wenn er mit was nichts anfangen kann, sagt Gott es nochmal in anders: "Ich höre nie auf zu Werden."
Das verschlägt Hans fast die Sprache. Weil es so anstrengend klingt: "Wieso das denn?"
"Ich werde, damit du wirst", sagt Gott.
Hans lächelt schief, er hat keine Ahnung, was Gott damit meint. Aber es klingt gut.
Berühr mich (nicht). Noli me tangere

Er ist tot. Mausetot. Auch, wenn sie es nicht wahrhaben will. Sie haben ihn in ein Grab gelegt, hierzulande sind das Höhlen. Sie werden mit einem Stein verschlossen. Eher einem Fels. Daran gibt es nichts zu rütteln. Seit drei Tagen liegt er da drin, eine ganze Ewigkeit also. Als Magdalena den Friedhof betritt, ist es noch früh. Der Horizont ist schwarz, nur ein paar Vögel versuchen, die Nacht zu verscheuchen. Auf dem Gras liegt Tau. Sie kann nicht sagen, was sie hier will. Warum sie gekommen ist. Hauptsache nicht länger herumsitzen und warten. Warten, dass ein Wunder geschieht. Sein Grab liegt ganz hinten, zwischen den Olivenbäumen. Ein schöner Ort zu Lebzeiten. Dort hätte es ihm gefallen, denkt sie und spürt den Stich, weil nichts mehr so ist, wie es normal war. Sie können sich nicht mehr verabreden, Brot und Wein auspacken, reden und lachen. Das Lachen fehlt ihr am meisten.
Ihre Füße streifen die feuchten Gräser. Jetzt müsste sie gleich da sein. Verunsichert bleibt sie stehen. Hat sie sich verlaufen? Nein. Da ist der Olivenhain, dort ist die Höhle. Nur der Stein ist weg. Dieser Fels. Jemand hat ihn zur Seite gewälzt, als hätte ein Riese seine Hände im Spiel gehabt. Die Höhle liegt offen und schwarz vor ihr. Sie schrickt zurück und zögert, aber dann setzt sie einen Schritt ins Dunkle. Dann noch einen. Ihre Augen müssen sich erst an die Schwärze gewöhnen, doch es bleibt dabei: Sie sieht nichts. Das Grab ist leer.
Magdalena stürzt hinaus, kopflos, wo haben sie ihn hingebracht? Tiefstehende Sonnenstrahlen blenden sie. Die Vögel halten den Atem an. Da hört sie ihren Namen. „Magdalena!“ Sie wendet sich um, eine halbe Drehung – und sieht ihn. Seine Augen leuchten, ihr Herz macht einen Sprung. Schon will sie zu ihm laufen, will ihn in die Arme schließen, doch er hält sie zurück: „Berühr mich nicht.“
Ich schrecke hoch. Im Zimmer ist es dunkel, meine Hand tastet nach dem Wecker. Zehn nach vier. Kein Olivenhain, sondern meine Zwei-Zimmer-Wohnung im dritten Stock. Es ist Woche vier der Pandemie, ich spüre schlafwarme Haut und denke: Ich will berührt werden. Nicht immer und nicht überall, ich bin nicht der Küsschen-hier, Küsschen-da-Typ. Aber Freundinnen würde ich gern umarmen. Dem Berater bei der Bank die Hand geben. Mit Freunden die Köpfe zusammenstecken, Schulter an Schulter sitzen. Und nun träume ich ausgerechnet in der Osternacht diesen Traum, und nicht mal der hat ein Happy End. Dabei habe ich eigentlich nicht viel übrig für die Hollywoodfilme mit ihren Geigen am Schluss, aber jetzt könnte ich ein Happy End wirklich brauchen.
Einmeterdreiundachtzig entfernt, am Fußende des Bettes sitzt Jesus und nickt: „Ich auch...“
Weiterlesen oder Weiterhören:
Ostermorgen

Steht einer im Licht
des allerersten Tages
zum Aufbruch bereit
Sagt: Halt nichts fest
und in meinen Händen
keimt eine Erinnerung
an Morgen
So frei

Einmal ging Jesus in die Wüste,
er musste etwas herausfinden,
er aß nicht, er sprach nicht, er schaute kein Netflix,
er twitterte nichts, vielleicht betete er.
Nach 40 Tagen war er hungrig
Und mit dem Hunger kam die Versuchung
Sie trug ein Regenbogenshirt
und ihre Stimme klang nach Mars Schokoriegel im Doppelpack:
„Wenn Gott wirklich mit dir ist, nimm dir was du brauchst
und lass diese Steine Brot werden.“
Aber Jesus schüttelte den Kopf:
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
sondern von Worten und Träumen, die aus Gottes Mund kommen.“
Die Versuchung gab nicht auf,
sondern nahm ihn ins Allerheiligste
und stellte ihn heraus aufs Höchste
und legte einen Glitter & Sparkle-Filter um ihn
dass er leuchtete, hell wie das Universum
und rief:
„Du bist der Größte! Zeig, was du kannst! Spring!
Steht nicht geschrieben, dass Engel dich auf Händen tragen?“
Aber Jesus stieß die Versuchung weg:
„Es steht auch geschrieben:
Du sollst Gott nicht auf die Probe stellen.“
Die Versuchung ließ noch immer nicht locker,
sie bot ihm alle Königreiche und das weltweite Netz,
und schenkte ihm 10 Tausend neue Follower auf Insta,
die berät wären, ihn anzubeten,
und ließ Likes und Konfetti regnen:
„Das alles“, rief sie, „gehört dir,
wenn du mich anbetest!“
Aber Jesus stemmte sich dagegen:
„Niemals! Ich will niemanden anbeten, außer Gott.
Ich bin so frei.“
Da gab sich die Versuchung geschlagen
und es kamen Engel und brachten Gin Tonic und Falafel
und ein frisches Hemd in Himmelblau.
nach Matthäus 4, aus der Wohnzimmerkirche auf Instagram am 26. März
Liebesglut

Der Papst sagt, er könne zwei, die einander lieben, nicht segnen, weil Gott ihren Sex nicht mag. Gott ist das unangenehm. Man könnte glatt den Eindruck bekommen, er drücke sich an fremden Schlafzimmerfenstern herum. Dabei drückt er sich höchstens in fremden Herzen herum, und die sind nicht mal fremd, sondern Zweitwohnsitze. Besonders da, wo die Liebe wohnt, ist er gern. Gott wärmt sich auf, bevor er weiterzieht zu den erloschenen Herzen. Dort bläst er in die Liebesglut, dass sie auflodern möge. Auch beim Papst schaut er immer wieder mal vorbei.
Sonntagssegen

Beim Aufwachen zu lesen
Bitte gönn dir was
das Konzert der Meisen
Milchschaumminuten
eine verlorene Uhr
Plüschgedanken
Der Himmel ist
ein Gemischtwarenladen
Er hat jetzt geöffnet
für dich
Vergiss nicht, was du willst

Lydia hat vier Sachen in ihrem Leben gelernt:
1. Wenn du Erfolg haben willst, brauchst du Kraft wie fünf Männer.
2. Du hast Kraft wie fünf Männer.
3. Vergiss die Kompromisse.
4. Vergiss nicht, was du willst.
Lydia will zusammen essen, Brot backen, Apfelbäume pflanzen und nach Gott Ausschau halten – denn zu vielen sieht man mehr. „Ich will beten und wenn es sein muss auch herumstottern, ich will zusammen singen, Lagerfeuer machen, das Sonderbare nicht scheuen, ich will fasten, Buttercremetorte backen und Buttercremetorte teilen, ich will feiern, Geschichten erzählen, Seelen trösten, Ja sagen, ich will helfen, handauflegen, zuhören, die Tür will ich weit öffnen, ich will träumen, ich will taufen, ich will den Himmel an die Wand malen. Ich will lieben, zusammengefasst.“
Da kann keiner nein sagen, und so wird Lydia die allererste Christin in ganz Europa, und die erste Gemeindevorsteherin, und die erste Bischöfin ist sie auch. Denn andere gibt es ja noch nicht.
Kleine Erinnerung zum Weltfrauentag aus: Eva und der Zitronenfalter. Frauengeschichten aus der Bibel
PS: Ich schreibe bis Ostern übrigens wieder täglich auf chrimonshop.de
Sonntagsstimmung

Sonntags bin ich der Mensch, der ich gern wäre. Die Zeit und ich sind uns ausnahmsweise einig: Es gibt nichts zu müssen. Allen Aufgaben gebe ich frei. Der Himmel steht offen, ich erhasche einen Blick, wie es sein könnte. Gott ist erleichtert, weil ich endlich gelöst bin. Eine Blume sagt: Riech mal. Ich mache ihr die Freude.
aus: Luft nach oben. Der Sonntagskalender
Alles offen
Jesus und Maria Magdalena

Sie ist unabhängig. Eben wie man das landläufig so meint: Unverheiratet, mit einem Konto ausgestattet, das sie selber füllt. Eine Bohrmaschine hat sie auch (nutzt sie aber ungern. Wegen des Lärms. Und so viele Löcher braucht man gar nicht im Leben).
Er liebt sie. Mehr als die anderen. Aber ein Paar sind sie nicht.
Sie haben nie zusammen geschlafen. Obwohl es Momente gab, in denen es folgerichtig hätte sein können. Als sie am See saßen und die anderen längst gegangen waren. Sie redeten, während der Mond seine Runde drehte, bis er hinter den Kiefern verschwand. Ich liebe es, sagte sie, wie du meine Geister vertreibst, durch die Nacht mit mir gehst.
Im ersten Licht des Morgens sind sie geschwommen, vielleicht waren sie nackt, sie hat es vergessen. Später saßen sie zusammen in einem Boot, Schulter an Schulter. Es war eng und nicht unangenehm. Ich liebe es, sagte er, dass du mich berührst.
Er mag ihre Nähe, die immer etwas Waches hat. Sie lässt sich nicht fallen. Er hat nie das Gefühl, der Stärkere sein zu müssen. Sie lehnen aneinander, mit den Füßen auf der Erde. Das Boot schaukelte, sie genossen die Wärme ihrer nackten Haut, Bein und Arm. Sie genossen einander, ohne etwas zu wollen. Falls sie es doch taten, behielten sie es für sich, um das andere nicht zu stören, das leicht war und ihnen Flügel gab. Sie lernten, dass man nicht alles mitnehmen muss, was sich anbietet. Manchmal findet sie ihn schön. Seine Augen würde sie unter allen Augen erkennen. Auch seinen Körper. Er ist glatt, wie Marmor. Aber das sagt sie ihm nicht. Stattdessen: Deine Füße liebe ich. Deinen Kopf liebe ich auch. Er mag ihre Schultern. Sie sind muskulöser, als man zunächst denkt. Sie ist keine Sportlerin, sie gehört nicht zu den Frauen, die diszipliniert und geplant vorgehen. Aber sie bewegt sich gern und er genießt es, ihr dabei zuzusehen. Ich liebe es, sagt sie, wie du mich ansiehst. Nie habe ich das Gefühl, ich müsste mich verstecken.
Ich liebe es, sagt er, wie du einen Raum betrittst und die Blicke nicht wägst. Wie du dein Ding machst ohne Furcht.
Ihr Lachen macht sie zu Verschworenen. Wenn sie reden, dann reden sie nicht nur mit dem Kopf, sondern mit allem. Manchmal räkelt er sich wie eine große, schwere Raubkatze, wenn er einen Gedanken verfolgt. Sie fürchtet nichts an ihm. Obwohl er scharf sein kann, sogar verletzend. Bei ihr ist er es nicht. Sie weiß nicht, warum. Dabei kann sie selber auch scharf sein. Und schroff. Er sieht es ihr nach. Sie brauchen nicht miteinander zu kämpfen. Es gibt nicht zu behaupten und nichts zu gewinnen. Sie kennen einander zu gut.
Ich liebe es, sagt sie, dass du mich sein lässt, wie ich bin. Das verwandelt mich.
Es heißt, dass sie viele Männer hatte. Viel ist eine schwammige Zahl. Sie liebt Worte mehr als Zahlen. Aber gegen Sex hat sie nichts einzuwenden. So ein Satz kann gegen sie verwendet werden. Es heißt, dass sie versucht hat, ihn zu verführen. Er aber nicht wollte. Er konnte ihr widerstehen. Ihr, der Versuchung. Obwohl es andererseits auch nicht schlimm gewesen wäre, wenn er nicht widerstanden hätte: Sex macht Männern zu echten Männern und Frauen zu fragwürdigen Frauen. Für alleinstehende Frauen wie sie ist das ein Dilemma: Zu viel Sex ist schlecht, kein Sex aber auch. Eine Frau ohne Mann, ohne Kinder muss unglücklich sein. Wenn sie nicht unglücklich ist, dann stimmt etwas nicht mit ihr.Sie weiß, dass die Leute so denken. Er weiß es auch. Aber es spielt keine Rolle. Ich liebe deine heilige Furchtlosigkeit, sagt sie. Dass du dich nicht sorgst, was die Leute reden.
Manchmal sind ihre Worte wie Küsse. Sie schmecken salzig und süß. Wie Honig-Erdnüsse, denkt sie. Er denkt an Krebsfleisch. Sie essen oft zusammen. Ungeplant, Zufallsessen auf eine beiläufige, verschwenderische Art. Er brät ein Ei und sie öffnet eine Flasche Wein. Dabei reden sie weiter, kauen die Worten oder lassen sie auf der Zunge zergehen. Ich liebe es, sagt er, dass du eine Verschwenderin bist. Du rechnest nicht. Du wärst so eine schlechte Buchhalterin. Selber, denkt sie und lächelt in sich hinein.
Sie zeigen einander viel. Er lernt ihre Dämonen kennen und hält ihnen stand. Zum ersten Mal hat sie das Gefühl, sie nicht verteidigen zu müssen. Er würde nichts gegen sie verwenden. Dafür bleiben sie sich fern genug, sie müssen einander nichts heimzahlen. Auch sie ahnt etwas von seinem Schmerz. Obwohl er ihn nie zur Schau stellt. Auch von seiner Wut. Wie ein Sommergewitter bricht sie manchmal herein, unerwartet und heftig. Aber sie fürchtet sich nicht vor Gewittern.
Ich liebe es, sagt er, dass du mich nicht festnagelst.
Ich liebe es, sagt sie, dass du dich mir zeigst.
Ich liebe dich, sagen sie und lassen alles offen.
aus: Kirschen essen. Liebesgeschichten aus der Bibel. Edition chrismon
Lichtmess

Um acht ist es hell. Ich feiere das Licht und die Fresien auf der Fensterbank. Im Erwachen gibt es einen virusfreien Raum.
Meine Träume haben mittlerweile Handtaschenformat,
ich trage sie überall mit hin. Der Himmel ist noch unentschlossen, aber ich bin bereit.
Hellsehen

Wir sind da, Gott
auf dem Sofa,
in Flauschpantoffeln oder Lackschuhen
Wir haben die Perlen für dich angelegt
das Haar gescheitelt
das Hemd geknöpft
du siehst uns
Unsere Blicke gehen ins Schwarze
und über das Schwarze hinaus
Unsere Blicke kreuzen sich in einem virtuellen Raum
Du bist längst dort
Du hörst
wie unsere Herzen schlagen
du hörst die Nachbarn nebenan
und die Kinder, die nicht müde sind
und das Schweigen in den Konzertsälen hörst du auch.
Ich zeig euch was, sagst du.
Ich zeig euch, wie man hellsieht.
Amen
Gestern haben wir zum ersten Mal Wohnzimmerkirche auf Instagram gefeiert. Ein Prost auf Käsebrot, große Schwestern, Ausbruchsmomente, weiße Kleider, königlich sein und das Sekundenglück, das bereit liegt, wenn wir es sind. @wohnzimmerkirche
Januarmorgen

Noch ein grauer Januarmorgen. Schneereste auf dem Dach. Ich hab die Kerze im Fenster angezündet. Darauf ging gegenüber der Stern an. Vor ein paar Tagen hat mir die Frau mit dem Baby zugewinkt. Leben wie im Setzkasten. Ich mag das. Gott wohnt wahrscheinlich in der Wohnung mit der Amaryllis. Es ist nie jemand zu sehen, aber viel Papierkram auf dem Tisch. Über der Amaryllis hängt ein Herz. Es ist ein bisschen kitschig. Aber auch schrebbelig, ein Geschenk, das hängengeblieben ist. Irgendwann werde wir gleichzeitig aus dem Fenster sehen.
Barmherzigkeit

Ich bin Bonbonzerbeißerin. Ich weiß, das ist eine schlechte Angewohnheit, meine Zahnärztin liest hoffentlich nicht zu. Was ich noch bin: Große Schwester. Steuerzahlerin. Überzeugte Bahnfahrerin. Hoffnungsvolle Optimistin. Ich habe viele Facetten. Wie jeder Mensch. Ich finde es eine erleichternde Vorstellung, dass es bei allen Menschen etwas geben könnte, das uns verbindet. Man muss nur lang genug suchen. So würde ich mit Herrn Trump politisch wahrscheinlich nicht einig werden. Aber vielleicht teilen wir eine Vorliebe für Minzschokolade.
Leider geht es im Leben nicht nur um Süßigkeiten. Rassistische oder andere verachtende Haltungen möchte ich nicht kleinreden. Dennoch bleibt eine Gemeinsamkeit: Wir sind Menschen. Dieser kleinste gemeinsame Nenner besteht, er bleibt sogar dann bestehen, wenn Menschen unmenschlich handeln. Sie bleiben Menschen, weil Gott sie als solche erschaffen hat. Der erste Tod in der Bibel ist ein Mord. Kain erschlägt seinen Bruder Abel und darf trotzdem weiterleben. Gott verurteilt sein Tun, aber schützt ihn als Mensch. Ein altes Wort dafür ist Barmherzigkeit. Es ist staubig geworden, dabei ist es ein schönes Wort. Es wärmt und verwandelt. Wer mutig ist, bläst den Staub weg und lässt es wirken. Nimmt sich ein Herz für die Herzlosen und die Feindseligen. Für einen allein ist das vielleicht zuviel. Aber zusammen könnte es uns gelingen, darauf zu bestehen, dass Menschlichkeit siegt.
Wo Gott wohnt (wenn Sommer ist)

Ich glaube, du hast eine Höhle im Wald
irgendwo im Unterholz
dort lebst du mit Ameisen und Feuerwanzen
die versuchen dich nicht einzusperren
und sind gesellig
Größe spielt keine Rolle
- soweit ich weiß -
Manchmal kommt eine Spitzmaus vorbei
Ich glaube
selbst Menschen
sind willkommen
Lustprinzip
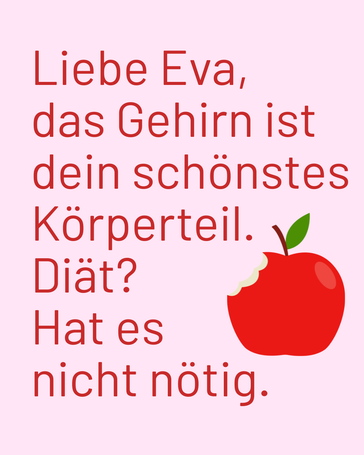
Liebe Eva,
ich bin Susanne. Ich mag Himbeeren und Gendersternchen und dich. Wenn ich an dich denke, denke ich an Emanzipation. Das Wort hast du erfunden. Ich seh dich, wie du auf der Schwelle stehst. Nach
draußen, ins Freie. Die Sicherheit lässt du zurück. Aber hej, denke ich - fürchte dich nicht. Gott hat die Sehnsucht in unser Herz gelegt. Nicht die Schuld. Lass dir das nicht einreden, auch in
hunderttausend Jahren nicht. Männer haben das lang genug versucht, um die Welt zu beherrschen und die Frauen dazu. Hier ist dein Platz, haben sie gesagt und die Mauern immer enger gezogen, bis
das Paradies nur noch vom Herd bis zur Wiege reichte.
Wenn es gut läuft, wirst du als Mutter aller Menschen bezeichnet, das ist auch so ein Ding: Wenn schon Frau, dann wenigstens Mutter. Okay, dann sage ich es mal so: Du hast uns die Lust am Denken
in die Wiege gelegt. Die Lust, zu fragen: Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum – wer nicht fragt, bleibt dumm.
Das Gehirn ist dein schönstes Körperteil. Diät? Hat es nicht nötig.
Es gebiert die Phantasie, die vorwegnimmt, was noch nicht ist, aber sein könnte. Und dazu haben wir ein funktionsfähiges Gewissen bekommen und ein Herz voll Empathie. Du bist nicht die einzige auf der Welt. Adam steht an deiner Seite, und das ist gut. Besser ist es zu zweit und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Ich bin eure Verbündete, und ich hab Lust. Weiterzudenken. Ich hab Lust, die Welt zu erforschen. Es gibt so viel zu entdecken. Amen, sagt Gott. Und gibt uns Proviant für unterwegs: Drei Äpfel und einen Sack Vertrauen.
aus: Drei Briefe an Eva. Wohnzimmerkirche, Lustprinzip
Mai!

Ich war mal Maikönigin. Also nicht offiziell, nicht mit Schärpe und Presse und Trallala. Es war einer dieser Tanz-in-den-Mai-Feiern, die man damals noch Feten nannte, und wir waren ziemlich unter uns. Irgendwo in der Nähe von Steinhude, falls euch das was sagt. Mein Ruhm währte kurz, ich nehme an, von Mitternacht bis zum Morgengrauen, was aber überhaupt nichts machte. Schließlich erinnere ich bis heute daran, wie das ist: Einmal Königin sein. Nicht, weil ich die Schönste war (war ich nicht). Nicht, weil ich am besten tanzen konnte (konnte ich nicht). Nicht, weil mein Vater bereits König war (eher Bauer). Ich hatte zufällig am überzeugendsten ein paar Scherzfragen beantwortet. Keine große Sache. Was ich sagen will, ist: wie gut sich das anfühlt, für einen Moment zu glänzen. Bejubelt zu werden, ganz ohne Grund. Kurz genug, damit es nicht zu Kopf steigt. Lang genug für das
Gefühl: Du bist wer. Du zählst. Sagt Gott, immer wieder, lebenslang. Sollten wir so oft es geht weitersagen. Zum Beispiel heute Nacht: Setzt doch mal jemandem eine Krone auf. Und tanzt, schwebt, stolpert, lauft zusammen in den Mai.
Als Frau Meckelbach aufersteht

Als Frau Meckelbach aufersteht, blühen die Narzissen. Im Grab ist es zu eng. Frau Meckelbach, litt Zeit ihres Lebens an einer leichten Form von Platzangst. Sie verlässt den Sarg und staunt, wie das möglich ist. Schließlich hat Egon massive Eiche gewählt, das, fand er, war er seiner Gattin schuldig. Und dann liegt ja auch noch eine Tonne Erde über ihr, ein unter normalen Umständen beängstigender Gedanke. Aber normal ist nichts mehr. Frau Meckelbach gleitet hinaus, ins Freie, ihren Körper lässt sie zurück. Ein kurzes Bedauern flammt in ihr auf, denn schließlich waren sie lange miteinander unterwegs gewesen. Andererseits gehörte Frau Meckelbach nie zu denen, die jedes Kleid aufheben müssen, weil es ja sein könnte, dass man es noch mal tragen würde. Nach einer Diät. Oder wenn die Mode wechselt. Frau Meckelbach braucht ihren Körper nicht mehr. Frau Meckel wird nie wieder Diät machen, sie atmet auf. Atmen funktioniert überraschenderweise. In ihrem Inneren ist ein so ungeheurer Drang nach Luft. Frühlingsluft. Sie saugt sie in sich ein, dass sie zu schweben beginnt, hinauf, hinauf, bis an die Grenzen der Vorstellungskraft. Und darüber hinaus.
Sturm. Wutbürgerinnen und Moralapostel

Morgens um halb zehn geht das Volk auf die Straße. Morgens um halb zehn sieht Herr Müller rot. Herr Müller ist wütend und brüllt. Zusammen mit den anderen. Hat einen Galgen gebaut, hat Bilder von Politikern drangehängt. Herr Müller ist enttäuscht, fühlt sich verraten und verkauft. Sein Gesicht ist hassverzerrt. Dabei ist er sonst ganz lieb und geht sonntags mit den Kindern in den Zoo. Herr Müller kann tausend Namen haben, Hans-Martin oder Kevin. Bill oder Claudia oder Salim.
Herr Müller lebt überall auf der Welt. Herr Müller ist tausend mal tausend Jahre alt. Herr Müller war auch damals dabei, an jenem Freitag und hat Jesus durch die Straßen getrieben, hat geschrien: „Tötet ihn! Tötet ihn!“ Damals hieß Herr Müller vielleicht Hanna oder Thomas. Herr Müller kannte Jesus nicht persönlich. Anfangs fand er ihn ganz gut. Weil der gesagt hat: „Ich ändere was. Echt. Himmel auf Erden, die Letzten werden die Ersten sein!“
In Herrn Müller war so eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, wobei er das nie so formuliert hätte. Aber dass etwas falsch läuft, das war eindeutig. Damals und heute und immer wieder: Die Reichen sind zu reich und die Armen zu arm. Die Mächtigen sind zu mächtig, und einer wie Herr Müller ist zu ohnmächtig. Und diese Ohnmacht, die macht ihn rasend. Und deshalb hat er zugehört, als Jesus redete. Hat an seinen Lippen gehangen und gesehen, wie 5000 Leute mucksmäuschenstill waren und satt wurden. Leute wie er. Ganz normale Leute.
Und jetzt läuft Herr Müller durch die Straßen und schreit. Wie konnte es bloß soweit kommen?
2000 Jahre und einen Tag zurück. Donnerstagmorgen:
Judas hat sich entschieden. Irgendwer muss handeln. Immer nur reden, reden, reden. Das führt zu nichts. Judas ist kein Hitzkopf und auch kein böser Mensch. Aber in seinem Bauch brodelt es. Judas
lebt in einem besetzten Land. Steuern und Zölle sind hoch. Die Korruption blüht. Immer wieder gibt es Aufstände, die brutal niedergeschlagen werden. Propheten versprechen ein neues
Zeitalter.
Einer dieser Propheten ist Jesus. Ihm hat Judas sich angeschlossen. Und jetzt ist er enttäuscht, genau wie Herr Müller. „Jesus?“, würde er sagen, wenn wir ihn fragen könnten. „Ist genau wie alle
anderen. Nichts als leere Versprechen.“ Dabei hatte er von ganzem Herzen an ihn geglaubt. Dass eine andere Welt möglich sei. Judas wollte den Umsturz der Verhältnisse. Wollte die Besatzer zum
Teufel jagen. Wollte, dass etwas ganz Großes passiert. Etwas, das alles ändert.
Jetzt ist Schluss. Jetzt nimmt er die Sache selbst in die Hand. Judas verrät, wo Jesus sich aufhalten wird in dieser Nacht. Verrät, wo sie essen werden, verrät, was er liebt. Kassiert ein
Säckchen Silber dafür (aber es geht ihm nicht ums Geld). Judas verrät Jesus und setzt auf Eskalation. Damit Jesus zeigen kann, wer er wirklich ist. Damit der Sturm losbricht.
Donnerstagabend:
Die Kerzen brennen noch. Noch schimmert der Wein im Glas. Noch sind sie alle zusammen. Da sagt Jesus: „In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern über mich.“ Werdet euch abwenden, irre werden,
werdet verletzt sein, beleidigt. Als sie das hören, bleibt ihnen der letzte Bissen im Hals stecken. „Ich niemals!“, ruft Petrus und braust wie immer ein bisschen auf. Aber Jesus redet einfach
weiter: „Die Menschen werden euch hassen, weil sie mich hassen.“ Die Worte stehen wie Gewitter im Raum. Aber noch entlädt sich nichts. Wieso Hass?, denkt Petrus. Woher kommt dieser Hass?
Alle schlafen. Obwohl man jetzt wach sein müsste. Der Sturm zieht auf. Seit Tagen schon. Wer Ohren hat, der höre. Zusammen könnte man das Schlimmste verhindern. Aber so schlimm wird es schon
nicht werden, oder? Es wird schon gut gehen. Ist bisher immer gut gegangen. Alle schlafen, Jesus betet. Allein. Beten ist Protest, der zum Himmel schreit. „Wacht auf!“, möchte man den anderen
zurufen. „So wacht doch auf, ihr Narren! Habt ihr schon vergessen, was mit Johannes dem Täufer passiert ist? Habt ihr vergessen, wie sie seinen Kopf auf einem Tablett präsentiert haben? Das ist
kein Einzelfall.“
Mitternacht:
Sie kommen. Sie kommen, ihn zu holen. Mit Schwertern und mit Stangen kommen sie. Petrus will kämpfen. „Was auch immer geschieht, ich halte zu dir“, hatte er versprochen. Jetzt ein Held sein, er
zieht die Klinge und sticht zu – aber Jesus greift ihm ins Messer. „Lass gut sein“, sagt er. „Steck die Waffe weg. Du wirst wen verletzen.“ Und dann sagt er noch: „Wer zur Waffe greift, wird
durch die Waffe umkommen.“ Sie führen Jesus ab, und er geht mit, widerstandlos. Warum?, will Petrus schreien. Warum?, will Judas schreien. Wo ist das Wunder, das du versprochen hast?
Freitag in aller Frühe:
Der römische Statthalter Pilatus verspeist ein Hühnerbein, als sie ihm den Angeklagten bringen: Störung der öffentlichen Ordnung. Aufwiegelung und Amtsanmaßung. Darauf steht die Todesstrafe.
Aufwiegler werden gekreuzigt. Das schreckt ab. Pilatus will die Sache schnell erledigen. Hauptsache kein Aufruhr. Denn Pilatus will Karriere machen. Der Rest ist ihm herzlich egal.
Pilatus mustert diesen Jesus. Er könnte ihn retten. Das wär mal was. Irgendwas imponiert ihm an dem. Stellt sich hin und sagt: Ich bin König. Drollig irgendwie. Tut keinem was zu leide. Das
bringt die Leute zur Raserei. Von draußen ist das Gebrüll zu hören. Pilatus befiehlt, die Fenster zu schließen. Er findet Kreuzigungen barbarisch. Etwas für den Pöbel.
Mit diesem Jesus könnte man sich vielleicht unterhalten. Er hält ihm ein Hühnerbein hin. Keine Reaktion. Schade. Wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, soll dieser Jesus dem Genuss nicht
abgeneigt sein. Und dabei als Redner talentiert. Etwas Abwechslung. Pilatus wischt sich die Finger an der Serviette ab und rülpst dezent. Die Schreie draußen werden lauter. Nützt ja nichts, denkt
er und geht hinaus.
Freitag, kurz nach Sonnenaufgang:
Pilatus tritt vor die Menge. Eine anonyme Masse. Er hat aufgehört, in Gesichter zu sehen. Für ihn sehen sie alle gleich aus. Ihre Wut und ihr Hass schlagen ihm entgegen wie ein Feuersturm.
Pilatus kann das nicht nachvollziehen. Einer wie er braucht keine Wut. Er setzt ein gütiges Gesicht auf und bietet ihnen Gnade an. Großherzige Gnade: „Den da“, sagt er und zeigt auf Jesus, „oder
Barrabas. Wen soll ich laufen lassen?“ Jesus, den Rebellen, der an den Himmel glaubt, oder Barrabas, den verurteilten Verbrecher. Einen, der nicht mal Worte als Waffe benutzt, oder einen Mörder.
„Barrabas!“, rufen sie. Immer wieder: „Barrabas!“ Sterben soll der andere. „Was hat er getan?“, fragt Pilatus. Aber seine Frage geht unter im Geschrei des Mobs: „Kreuzigt ihn! Kreuzigt ihn!“
Barbaren, denkt Pilatus und geht hinein, um sich die Hände zu waschen.
Freitag, gegen Mittag:
Die Soldaten hämmern Nägel ins Kreuz. Mitten durch die Handgelenke, später auch durch die Fußgelenke. Sie können das gut, ihre Schläge sind schnell und kräftig. Die Schreie könnten Tote
aufwecken, aber sie hören sie nicht mehr. Der da ist nur noch ein Bündel Fleisch. Da, wo das Gesicht war, ist Blut. Die Folter gehört zur Strafe.
Sie haben getrunken, vielleicht sind auch Drogen im Spiel, das nimmt niemand so genau. Irgendwer muss die Drecksarbeit machen. Sie tun nur ihre Pflicht, und irgendwas wird schon dran sein.
Unschuldig sind die doch alle nicht. Außerdem gibt es Zulagen, sie spielen um die Kleider der Verurteilten, weil wer da oben hängt, der braucht nichts mehr zum Anziehen – die Blutflecken
kriegst du eh nicht mehr raus – haha! Wer die härtesten Witze macht, kriegt einen Schnaps.
Freitagnachmittag:
Jesus hängt am Kreuz. Die Menge hat sich zerstreut, der Sturm ist gestillt. Jetzt kommt nichts mehr, außer dem Tod. Die Frauen bleiben. Können nichts tun, aber bleiben. Die Frauen haben auch
Namen, das vergisst man schnell. Dreimal Maria: Seine Mutter. Seine Tante. Und Maria aus Magdala, seine – was eigentlich? Vertraute, Geliebte, Freundin, Verbündete? Sie laufen nicht weg. Es ist
nicht ungefährlich, was sie tun. Man sympathisiert nicht mit Rebellen. Dennoch bleiben sie. Das Dennoch ist ihr Protest. Sie können nichts tun, außer da sein. Das ist so ein Frauending, sagen die
einen. Mitleid nennen es die anderen. Wo ihre Wut ist, wissen wir nicht. Sie ist nicht zu sehen. Vielleicht hat sie sich verwandelt: zu Mut in kleinen Portionen.
Später:
Jesus schreit. Das will man nicht hören. Helden sterben lautlos. Aber Jesus schreit. Schreit seine Ohnmacht heraus. Wo sind die Freunde? Pilatus isst das letzte Hühnerbein. Die Soldaten haben
Feierabend. Der Hass kommt vorbei und lästert: „Hilf dir doch selbst. Zeig, was du kannst.“ Jesus schreit. Meine Wut stimmt ein.
Noch später:
Jesus stirbt. Der Himmel verdunkelt sich.
Gott schweigt. Ewig und drei Tage.
Dann wischt Gott das Blut auf.
Malt damit ein Herz.
Gott sieht rot. Morgenrot.
Am Morgen danach tritt Herr Müller auf die Straße. Es ist still, sehr still.
„Wut“, sagt Gott. „Kenne ich.“
„Du?“, fragt Herr Müller.
„Wut ist enttäuschte Liebe“, sagt Gott. „Aber wer wütend ist, ist noch lebendig. Wer wütend ist, ist noch nicht kalt. Wer wütend ist, dem ist noch nicht alles egal. Du kannst die Wut
zurückverwandeln.“
Herr Müller weiß nicht so recht, wie das gehen soll.
„Durch Übung“, sagt Gott. „Liebe ist die einzige, die dich retten kann. Such nicht im Sturm. Such nicht im Feuer. Warte nicht auf das große Beben. Ich bin der stille, sanfte Hauch.“
Herr Müller ist nicht gut im Spüren. Aber irgendetwas geht ihm gerade unter die Haut.
Kann man auch hören: Gesendet am Karfreitag im Deutschlandfunk, 18. April 2025 ,
Kara (Kummer, Klage)
Gott ist gestorben.
Mit schwarzen Flügeln fliegt er davon.
Ich bleibe zurück, unruhig,
weil ich nicht weiß, was jetzt zu tun ist.
Wer kümmert sich um die Wildgänse auf den Wiesen?
Wer weiß, wie man ein Herz flickt?
Wer bestellt den Regen?
Wer backt das Brot?
Am Boden ist Totenstille.
Selbst der Wind hält die Luft an.
Du musst atmen, sagt Gott.
Damit sich etwas bewegt.
Selig sind die Narren

Als Jesus kommt, gucken alle erstmal in die falsche Richtung. Weil, ein König müsste doch mit einem Privatjet kommen oder mindestens mit einer Limousine (nur Tesla geht jetzt nicht mehr). Vielleicht auch mit der Bahn, weil Jesus so einen Ruf als Öko hat, dann aber wenigstens erste Klasse. Nur: Da kommt nichts. Am Horizont gähnende Leere. Bis von der anderen Seite ein Esel herantrottet, gemächlich, weil hier und da sich noch ein Löwenzahn zum Fressen anbietet.
So ein Esel ist sich der Tragweite seiner Rolle nicht bewusst.
Er versteht auch nicht zu glänzen wie ein Pferd. Aber zum Glück ist sein Reiter geduldig. Wobei – er reitet ja gar nicht. Er sitzt. Besonders majestätisch wirkt das nicht; sitz mal auf einem Esel, die Beine baumeln ins Nichts, und das Tier tut sowieso, was es will. Du brauchst gar nicht erst versuchen, es zu beherrschen. Du kannst froh sein, wenn es läuft. Jesus sieht aus, als koste er die Verwirrung aus. Der Esel trottet am roten Teppich vorbei. Ein Staatsbesuch sieht anders aus, die Anzugträger wissen nicht, wohin mit sich, und auch der Herr Bischof zögert, seinem König zu folgen, wegen der italienischen Schuhe, die sehr empfindlich sind.
Die Leute aber ziehen ihre Jacken aus, werfen Schal und Hemd auf die Straße, brechen Zweige von den Bäumen, jubeln, streuen Blüten und feiern ihn. Sie haben so die Nase voll von den Eitelkeiten der Oberhäupter, Hosianna, rufen sie. Endlich einer, der sich nicht so wichtig nimmt.
In den Abendnachrichten kein Wort von ihm, nur Krieg und Kämpfe um Macht und Eier, und ein paar Gockel sind auch zu sehen. Aber wer will sich das schon anschauen? Das Leben findet woanders statt. Selig sind die Narren, ruft Jesus, denn sie werden die Ordnung auf den Kopf stellen. Ihnen gehört das Himmelreich! Ob das zu sagen nicht gefährlich sei, fragen einige. Man höre immer häufiger von Zensur, von Repressionen, von Schlimmerem, mit dem zu rechnen sei.
Aber sowas hat Jesus ja noch nie gestört.
Wenn die Welt wankt

Ich mag das rote Radio in meiner Küche. Ich mag den Schaukelstuhl und das glitzernde Kaninchen, das auf meinem Schreibtisch steht. Aber lebenswichtig ist das alles nicht. Bisher musste ich mir noch nie ernsthaft und existenziell die Frage stellen, was lebenswichtig ist. Zum Glück. Weil ich in einem Land lebe, das so stabil ist, dass ich keine Bombe fürchte, die mir aufs Dach fällt. Weil ich nachts ruhig schlafen kann, ohne dass marodierende Gangs durch die Straßen ziehen. Weil es bei allem, was schiefläuft, Rechtstaat, Demokratie und eine freie Presse gibt. Und Erdbeeren vom Markt. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann ist es die Sicherheit, dass das so bleibt.
„Sorry“, sagt Gott. „Sicherheit gibt es nicht. Was ich dir anbieten kann, ist Vertrauen.“
Das hätte ich mir denken können. Sicherheit versprechen nur die Profiteure der Angst. Aber Vertrauen? Worauf?
„Du bist nicht allein“, Gott sagt. „Erstens bin ich bei dir. In dir drin. Ob du’s glaubst oder nicht. Und zweitens sind da die anderen: Freundinnen und Verbündete. Nachbarn und Zufallsbegegnungen. Eine Tante, die wiederauftaucht oder der freundliche Käseverkäufer auf dem Markt. Wenn die Welt wankt, hilft es, sich aneinander festzuhalten.“
„Amen“, sage ich. Unsicher, aber mutig. Zusammen bleiben wir stabil.
Zuversicht

Der Himmel strahlt heute eine gewisse Zuversicht aus,
sage ich.
Jonte nickt. Eine Möwe fliegt vorbei.
Die Möwen, sagt Jonte, sind die Seelen der Matrosen.
Die Möwe kackt auf seinen Kopf. Zum Glück trägt er Mütze.
Die Seele muss sich auch mal erleichtern, sage ich.
Isso, sagt Jonte.
Und dann schweigen wir wieder.
Kurz mal zu Jesus

Kurz mal zu Jesus. Das ist der mit dem Kreuz. Wegen ihm gibt es eine ganze Religion, genau, das Christentum.
Jesus ist schon eine Weile tot. Genauer gesagt: Er wurde getötet. Gekreuzigt. Das war damals eine typisch römische Strafe für Schwerverbrecher. Jedenfalls solche, die keine römischen Bürger waren. Eine Foltermethode, langsam und grausam. Ich glaube nicht, dass Jesus aus freien Stücken gesagt hat: Klar, mache ich. Jesus wurde hingerichtet, weil er unbequem war. Er hat die bestehende Ordnung und Hierarchien in Frage gestellt, er hat Massen mobilisiert (mal vier-, mal fünftausend). Er hat Freiheit für Gefangene und Unterdrückte gefordert. Er wollte die Welt gerechter machen.
Damit seine Botschaft weiterlebt, gibt es die Kirche.
Die Kirche war eine Untergrundorganisation.
Das vergisst man manchmal. Anfangs gab es keinen Reichtum, keinen Prunk, keinen Einfluss. Anfangs war es richtig gefährlich, dabei zu sein. Heute sagen Manche: Die Kirche soll dekorativ sein und Amen sagen und nicht weiter stören. Vor allem soll sie sich nicht in Politik einmischen. Jesus hat ziemlich gestört. Die Mächtigen und die Reichen, er hat die Unterdrücker beim Unterdrücken gestört. Und Männer, die gern vergöttert werden wollten, hat er auch gestört. Eigentlich war das meiste, was er gesagt hat, unbequem und sehr radikal: Liebe deine Nächsten (auch wenn sie anders leben als du). Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. (Warum besitzen einzelne Menschen Milliarden?) Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. (Autsch.) Die Liste lässt sich fortsetzen, nachzulesen in den Evangelien.
Was Jesus sagt, ist unbequem.
Damals wie heute. Die Überlieferungen sind 2000 Jahre alt. Manches wurde nachträglich bearbeitet oder zugefügt. Und natürlich lässt sich nicht alles eins zu eins auf unsere Zeit übertragen. Aber die Botschaft von Jesus bleibt: Ich bin nicht gekommen, Harmonie zu verbreiten, sondern Streitgespräche zu führen. Mischt euch ein. Eine andere Welt ist möglich: Wie im Himmel so auf Erden.
Wer Kirche will, muss mit Jesus klarkommen. Und wer Jesus will, kann nicht zu allem Ja und Amen sagen.
Herzmuskel

Diese Woche ist der Himmel blau und ich gehe wählen.
Am Wochenende hätte meine Oma Geburtstag gehabt, sie wäre dann 103 geworden. Ich hoffe, es gibt Torte im Himmel, denn meine Oma war die Königin der Torten. Torte gab es zu wichtigen Anlässen und
Anlässe hatten für meine Großeltern eine Bedeutung. Der Wahlsonntag war einer davon. Ich sehe sie, wie sie ihre Mäntel anziehen und Hut aufsetzen. „Was wählt ihr?“, habe ich als Kind gefragt.
Wählen schien eine geheimnisvolle und aufregende Sache zu sein. Meine Großeltern erklärten mir, was ein Wahlgeheimnis ist und warum das was mit Freiheit zu tun hat. Denn sie hatten erlebt, wie es
ist, wenn die Demokratie stirbt. Mein Opa konnte sich über das Gebrüll eines Hitlers ereifern, er hat später viele, viele Dokumentationen geschaut. Auch mit mir. Manchmal schüttelte er sich.
Wieder und wieder fragte er: Wie konnten wir so verblendet sein? Wieso haben wir das zugelassen? Willst du mit solchen Leuten am Kaffeetisch sitzen?
Vielleicht ist das nicht das entscheidende Wahlkriterium, aber ein Gradmesser ist es schon: Mit wem würde ich Omas Torte teilen? Sicher nicht mit den Lautesten. Sicher nicht mit Schreihälsen, die
ihre Häme und Hetze über Omas Kaffeetisch ausschütten. Solchen Leuten traue ich auch sonst nichts Gutes zu.
Postkarte: www.editionahoi.de
Heiliger Schrecken

Frau Immergrün zieht sich zurück. Ins Private. „Das kann man ja nicht aushalten“, sagt sie und meint: was in der Welt geschieht. All die Männer, die so tun, als seien sie der Heiland persönlich.
Seit neuestem gibt es auch Frauen unter ihnen. Anfangs hat sie noch demonstriert, gegen die AFD und ihre Hetze, für Klimaschutz und Weltfrieden. Sie hat Kerzen angezündet und mit Engelszungen
geredet. Sie hat auf die Vernunft gesetzt: die USA würden doch nicht wirklich ein zweites Mal Trump als Präsident wollen? Sie wollen. Zusammen mit den reichsten Männern feiert er sich. Und zu
allem Überfluss klebt seit gestern am Briefkasten ihrer Nachbarin ein Sticker mit der Aufschrift „Biodeutsch statt Bio-Fleisch“.
Frau Immergrün ist so müde.
Sie will sich die Decke über den Kopf ziehen und erst wieder aufwachen, wenn die Welt wieder in Ordnung ist. Wenn man ohnehin nichts ändern kann, kann man es auch sein lassen. Selbstfürsorge sei
in diesen Zeiten wichtiger denn je, hat Frau Immergrün gelesen und plötzlich eine so unglaubliche Sehnsucht nach Flausch gespürt. „Ich kapituliere. Ab sofort halte ich mich raus. Statt
Nachrichten schaue ich nur noch Panda-Videos.“
„Aber nein“, sagt Gott, „tu das bitte nicht!“, (und es ist wirklich selten, dass Gott sich einmischt).
„Du!“, ruft Frau Immergrün, „du hast mir gerade noch gefehlt. Du könntest ja was unternehmen. Könntest durchgreifen und die Welt wieder ins Gleichgewicht bringen. Da schwadroniert ein selbstverliebter Präsident, von Gott selbst auserwählt zu sein und du – schweigst.“ Frau Immergrün ist überrascht, wieviel Wut sich in ihr angestaut hat.
Gott versteht das. Aber Gott ist kein Schlägertyp: „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“
Dann ist es still. Nicht mal die Fliege am Fenster wagt es, ihre Flügel zu spreizen. Man könnte meinen, die Welt bliebe stehen. Aber so einfach geht das natürlich nicht. Frau Immergrün schüttelt
ein Kissen auf und überlegt, ob die Wand eine neue Farbe vertragen würde. Irgendwas in Pastell. Gott geht nicht weg. Gott bleibt. Und sagt: „Ich brauche dich. Bitte. Lass mich nicht allein mit
diesen Möchtegern-Göttern, mit ihrem Egoismus und Größenwahn.“
Frau Immergrün hört plötzlich den Schrecken in Gottes Stimme. Und da besinnt sie sich: Nein, denkt sie. Nein, das kann ich dir wirklich nicht antun.
erschienen in: Innehalten_Magazin
Nachhilfe

Hallo Jesus,
du hast geglaubt:
eher kommt ein Kamel durchs Nadelöhr
als ein Reicher in den Himmel.
Du hast gesagt:
Ich bin fremd gewesen
und ihr habt mich aufgenommen.
Du hast geträumt:
von einer Welt, in der Liebe regiert.
Klappt gerade nicht so.
Gib uns Nachhilfe,
wir bleiben dran.
Friedenspfeife

Die Welt ist voll Übel und heimlich wünsche ich mir manchmal, Gott würde durchgreifen. Weil ich selber nicht weiterweiß. Ich sage das natürlich nicht laut, denn ich glaube ja eigentlich nicht an Allmacht. Wenn es sie gäbe, hätte sie in jahrtausendlanger Geschichte ziemlich versagt. Trotzdem sterben Allmachtsfantasien nichts aus. Ein starker Mann soll es richten (wenn es sein muss, auch eine starke Frau). Das ist gerade unglaublich populär. Dass es starke Männer waren, die die schlimmsten Kriege entfesselt haben, ist eine Ungereimtheit, die dabei nicht weiter zu stören scheint.
Eine Seite von mir will also einen mächtigen Gott.
Er soll regeln, was die Weltgemeinschaft gerade nicht hinkriegt. Das wollen die anderen auch, die nennen Gott Trump oder Trump Gott, die Grenzen scheinen da fließend zu sein. Seit neuestem betrachtet sich auch Alice W. als inkarnierte Liebe. Das ist natürlich ein Fake-Profil, die Liebe tritt zwar in vielerlei Gestalt auf, ganz sicher aber hetzt sie nicht, hasst nicht, lügt nicht. Die Liebe ist, anders als die Äußerungen von Alice, freundlich, sie ereifert sich nicht, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen. Der Liebe geht es nicht um Macht, sondern um Miteinander.
Jesus raucht eine Friedenspfeife aus Zucker und sagt: „Gott ist die Liebe, also wird das mit dem Durchgreifen nichts.“ Ich sage: „Schade“, und Jesus sagt: „Macht nichts, Gott ist in den Schwachen mächtig.“ Ich wende ein, dass Schwäche gerade nicht so gut ankommt. Jesus sagt, Schwäche sei noch nie gut angekommen. Damit kenne er sich aus. Die eigentliche Stärke läge darin, das auszuhalten. „Aber Liebe heißt nicht, alles zuzulassen. Weil dann aus Liebe Missbrauch wird.“
Dann bietet er mir einen Zug aus seiner Pfeife an. Ich schüttele den Kopf, weil ich keinen Zucker esse. Er nickt und lächelt, mit so viel Verschiedenheit können wir leben.
Kinderspiel

Als am 24. Dezember der Krieg fortgesetzt werden soll, geht Marie in die Kommandozentrale des Heeres und sagt zu ihrem Gatten, dem General: »Hier, dein Kind.«
Sie legt den Säugling in seinen Arm, händigt ihm ein Fläschchen trinkwarme Milch, Windeln und ein Plüschkrokodil aus. Der General ist so überrascht, dass ihm kein einziger Befehl einfällt: »Aber wie stellst du dir das vor? Ich kann nicht, ich habe zu tun!«
»Ich auch«, erwidert Marie. »Du bist dran.«
Die Tür schließt sich hinter ihr, und da steht der General mit einer Packung Windeln und einem Plüschkrokodil und bevor er sich einen Überblick über die Lage verschaffen kann, beginnt das Kindlein erst zu jammern, dann zu schreien, sodass es dringend herauszufinden gilt, wie es zu beruhigen ist. Bei dieser Art von Lärm lässt sich unmöglich ein anständiger Krieg führen. Das Kind muss befriedet werden. Was nicht unbedingt zu den Kernaufgaben des Generals gehört. Außerdem kommt es sehr ungelegen. Krieg ist schließlich kein Kinderspielplatz und der Gegner wartet nicht, bis ein Säugling gewickelt ist.
Eine Tagesmutter aufzutreiben, erweist sich in der Eile als aussichtslose Mission. Tagesmütter gehören nicht zum Profil einer Armee, weswegen der General den Gefreiten Kösters zur Betreuung abkommandiert. Überraschenderweise ist der Gefreite nicht abkömmlich. Er hält bereits selber zwei Babys im Arm. Zwillinge, geboren am Nikolaustag. Überdies habe auch der Feind Probleme mit Babys. Ob man die Schlacht verschieben könne, am besten auf die Stunde während des Mittagsschlafs, dann allerdings ohne schweres Geschütz, um die Kleinen nicht zu wecken. Schlecht gelaunte Säuglinge stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. An ein geordnetes Kriegsgeschehen ist nicht mehr zu denken. Aufklärer des Heeres bringen übereinstimmende Kunde: Sämtliche Frauen inner- und außerhalb der Landesgrenzen seien aufgebrochen und haben den Männern Babys in die Arme gedrückt: »Hier ist dein Kind. Hier ist deine Nichte, dein Neffe. Brüderchen und Schwesterchen.« Nach Angaben des Geheimdienstes liegen nun Hunderte, nein Tausende Säuglinge in Uniformsarmen, um gefüttert, gewickelt, gewiegt zu werden. Auch Terroristen und Söldner, so hört man, seien außer Gefecht gesetzt und haben alle Hände voll zu tun, um Milch zu wärmen und hungrige Münder zu stillen, sodass an einen anständigen Krieg überhaupt nicht mehr zu denken ist.
Der General ist außer sich. Auf eine derartige Situation ist er nicht vorbereitet. Es bräuchte einen Krisenstab, aber im Augenblick ist der General mit einer erheblich größeren Krise beschäftigt: Das Plüschkrokodil ist verschwunden, und wenn es nicht innerhalb der nächsten dreieinhalb Minuten wieder auftaucht, droht die Welt unterzugehen. Er weiß nicht, wo ihm der Kopf steht. Die Befehlskette funktioniert nicht mehr. Der Herrscher des Landes jagt gleich drei Säuglingen hinterher, die über das Muster seines seidenen Teppichs krabbeln. Sein Motto war immer: Je mehr Kinder, desto besser, und deshalb hatte er zur Sicherheit Cynthia, Olivia und Diane gleichzeitig befruchtet. Aber damals hatte er ja nicht ahnen können, wohin das führen würde. Dass er die Saat seiner Lenden nun plötzlich selbst an der Backe beziehungsweise in den Armen hatte. Von wo aus sie immer wieder entflutschte, es war schlicht unmöglich, drei Säuglinge gleichzeitig zu halten. Er brüllt, sein Berater möge erscheinen, aber plötzlich. Aber Brüllen ist keine gute Idee, weil die Babys direkt einstimmen. Der Lärm übertrifft jeden Tornado, und außerdem ist der Berater damit beschäftigt, seine eigene Zweijährige einzufangen, die gerade im Begriff ist, mit einer Handgranate Fußball zu spielen. Überall sind plötzlich Kinder, winzige, quirlige, sehr lebendige Kinder, dass man keine Hand mehr frei hat, um ein Maschinengewehr zu bedienen. Und niemand, wirklich niemand will seinen Platz im Panzer mit einem Säugling in voller Windel teilen.
Es ist ein Albtraum.
An Krieg ist wirklich nicht mehr zu denken.
Frohe Weihnachten.
aus: Der Stolperengel. 24 funkelnagelneue Weihnachtsgeschichten, Herder Verlag
mit llustrationen von Nina Hammerle
Kürbis statt Kapitulieren

Rilke sagt, der Sommer war groß, die Kirchen feiern Erntedank und durch meine Timeline rollen Kürbisrezepte. Der Herbst ist die sentimentalste der Jahreszeiten. Über allem liegt ein Goldfilter. Was jetzt nicht getan ist, wird nicht mehr getan. An den Türen hängen Kränze aus Hagebutten (fünf Euro der Zweig), die Welt soll bitte draußen bleiben. Altäre werden mit Möhren und Pastinaken und Ährenbündeln geschmückt, dabei greifen die meisten doch lieber zur toskanischen Gemüsepfanne aus dem Tiefkühlregal. „Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land“, singen ein paar Textsichere und denken dabei an die Tüte mit den Kressesamen, die immer noch im Schrank liegt.
Alles, was ich geerntet habe, sind zwei Kastanien.
Sie haben es irgendwie in meine Jackentasche geschafft, man kann sie weder essen noch konservieren, in drei Wochen werden sie schrumpelig sein, aber jetzt fühlen sie sich gut an. Jesus hat sich auf den Altar gesetzt und pult die Körner aus den Ähren. Ich sage, er solle das lassen, das sei Deko. Aber von Deko hält Jesus nichts und ernten ist sowieso nicht seine Sache, er sät lieber. Selbst jetzt im Herbst, wo eigentlich alles gelaufen ist. Mit vollen Händen wirft er seine Saat unter die Leute, und wenn die Hälfte seiner Worte unter die Dornen fällt und im braunen Morast erstickt, entmutigt ihn das nicht. Er sagt Worte wie Frieden und Liebe. Das ist auch ein bisschen retro, jetzt, wo man wieder sagen darf, dass die Ausländer raus müssen und die Grünen weg, weil man dann erstmal einen Schuldigen hat. Damit kennt sich Jesus gut aus. Hauptsache, man nagelt wen ans Kreuz, das ändert nichts an den eigentlichen Problemen, aber es lenkt ab. Ich frage, ob ihn das nicht frustriert. Immer das gleiche, die Menschen lernen nichts, auch in 2000 Jahren nicht.
Da möchte man doch den Kopf in den Acker stecken.
Aber Jesus ist selber abgelenkt, er scrollt durch Kürbisrezepte. „Guck mal“, sagt er, „das kenne ich noch nicht. Das probiere ich heute Abend aus. Kommst du? Bring mit, wen du willst, der Topf ist groß.“ Ich will einwenden, dass Suppe auch keine Lösung ist. Aber dann halte ich mich an meiner Kastanie fest und nicke tapfer, weil Jesus schon immer mehr fürs Tun als fürs Lamentieren war. Kürbis statt Kapitulieren.
Sandkornsegen

Gott sitzt im Sand
und segnet dich
Sandkorn für Sandkorn
rieselt in die Lücken
die du nicht zu füllen brauchst
Geh, sagt Gott. Ich bleibe
Gott sitzt im Sand
und segnet dich
Sandkorn für Sandkorn
Segen
aus: Wohnzimmerkirche im September
Streik

Als die Freiheit streikte, stand sie mit einem selbstgebastelten Schild in der Fußgängerzone. Sie stand ganz allein da und tat mir leid, weil niemand sie beachtete. Irgendwer protestiert ja dauernd wegen irgendwas; fürs Klima, gegen den Krieg – in der Ukraine oder im Gaza, von Afrika rede ich erst gar nicht, ich bin schon froh, wenn es am Küchentisch friedlich ist. Damit habe ich genug zu tun.
Ich sehe, wie die Freiheit tapfer ihr Schild in die Höhe hält: „Unterstützung gesucht!“, lese ich, und spüre, wie Ärger in mir hochkriecht. Was sollen denn andere sagen! Die Freiheit kann doch machen, was sie will, während unsereins um acht im Büro sein muss und die Waschmaschine piept und die Kinder wollen Schokopops und anschließend muss man sie zum Zahnarzt schleppen ob sie wollen oder nicht. Man muss die Steuererklärung machen, sich für eine Zahnzusatzversicherung entscheiden, muss aufgeklärt sein über die Gefahren der KI, muss Abkürzungen kennen, um mitreden zu können, muss Katzenbilder in der Familiengruppe posten – was denn noch alles? Ich steigere mich da so richtig rein, plötzlich tut mir die Freiheit gar nicht mehr leid, im Gegenteil, ich werde immer wütender, weil die Freiheit sowas Anklagendes hat. Als seien wir Schuld an ihrer Misere. Dabei ist sie es doch, die dauernd abwesend ist. Wieso hat sie überhaupt Zeit, da zu stehen, gibt es denn nichts Wichtigeres zu tun? Daran sieht man doch, wie überflüssig sie eigentlich ist. „Eine wie dich muss man sich erstmal leisten können“, rufe ich und erschrecke über die Worte, die da aus meinem Mund kommen. Die Freiheit lächelt müde. „Mich gibt es umsonst“, sagt sie. „Du musst nur aufpassen, dass du mich nicht verlierst.“
Schwimmflügel

„Wir müssen reden“, sag ich und Gott guckt, als hätte sie gerade einen Rollmops verschluckt. Oder er, ich komme da immer noch durcheinander, es verwirrt mich, dass Gott so uneindeutig ist.
„Reden“, sagt Gott, „immer willst du reden.“ Dabei bläst sie ein paar Schwimmflügel auf. Ich lasse mich nicht beirren: „Das Klima, die Rechten, die allgemeine Unzufriedenheit und dann noch die Deutsche Bahn – das geht doch so nicht weiter. Du musst was tun!“
„Ich tue was“, sagt Gott und reicht mir die Schwimmflügel. Sie sind orange, neonorange.
„Was soll ich damit?“
„Die helfen dir, nicht unterzugehen.“
„Ich kann schwimmen.“
„Ich weiß“, nickt Gott und setzt eine Taucherbrille auf. „Aber damit kannst du dich auch mal treiben lassen.“ Dann taucht sie ab.
„Das ist alles, was du für mich tun kannst?“, rufe ich ihr hinterher. Im selben Moment kreischt eine Möwe, die Luft riecht nach Nivea, und das Wasser glitzert mir entgegen.
Kleine Pfingstgeschichte

Vor 2000 Jahren, es ist Frühling, sitzen fünf Frauen und zwölf Männer unter einem Dach. Vielleicht waren es auch mehr. Fenster und Köpfe sind vernagelt, ihr Raum ist eng. Es ist gerade mal 50 Tage her, da wurde ihr Freund umgebracht. Wurde gefoltert und an ein Kreuz genagelt, wurde hängen gelassen, bis er tot war. Und allen, die zu ihm gehörten, wurde gedroht: Euch kriegen wir auch noch. Seitdem ist nichts mehr sicher. Zwar treffen sie sich auch nach Jesu Tod regelmäßig. Aber die Angst sitzt immer dabei. Obwohl er tausendmal gesagt hat: „Fürchtet euch nicht!“
Anfangs, in den ersten Wochen, war alles noch so lebendig. Da war er noch da. Beim Essen, wenn sie zusammensaßen, unterwegs. Sie spürten noch seine Kraft. Sie hörten noch seine Stimme: „Der Himmel ist ganz nah. Er hat längst begonnen.“ Mit der Zeit wurden die Worte leiser, bis sie schließlich ganz verstummten.
Seit zweitausend Jahren warten fünf Frauen und zwölf Männer auf ein Wunder. Vielleicht sind es auch mehr. Und plötzlich, an einem ganz normalen Tag im Frühling, passiert etwas. Es beginnt mit einem Kribbeln. Im Bauch oder in der Herzgegend. Aus dem Kribbeln wird ein Brennen, es entfacht sie zu neuem Leben. Plötzlich erinnern sie sich wieder: „Wo sind eigentlich unsere Träume hin? Wie konnten wir die vergessen?“
Sie öffnen die Tür und stürmen ins Freie. Viel zu lang haben sie hinter den Mauern gehockt. Viel zu lang haben sie geglaubt, jedes Wort aus seinem Mund konservieren zu müssen, damit bloß nichts verloren geht.
Plötzlich ist die alte Begeisterung wieder da, plötzlich haben sie wieder Rückenwind: Eine stimmt ein Lied an. Einer dichtet eine Ode an die Freiheit. Gemeinsam rufen sie: „Wir sind mehr!“ Alle reden durcheinander, das ist kein Chor, das ist Chaos. Und Gott schwebt über dem Chaos und ist froh, dass wieder Leben in ihnen ist.
Auf der Straße bringen sie den Alltag ins Stolpern. „Was sind das für Leute?“, fragt eine Passantin.
„Ist denn schon Feierabend?“, wundert sich ein Kommunalbeamter.
Und ein Priester empört sich: „Die sind doch betrunken!“ Hunde bellen und ein Huhn entwischt dem Beil des Schlachters.
„Hier kommt die Zukunft“, rufen sie. „Und sie beginnt jetzt! Die Alten werden ihre Träume erzählen. Die Jungen werden ihre Utopien leben. Zusammen werden wir Prophetinnen und Propheten sein!“
Ein Kreis aus Menschen bildet sich um sie. „Sind das nicht die, deren Anführer getötet wurde? Wie kommt es, dass sie lachen?“
Erklären können sie das nicht. Trotzdem versuchen sie es. Sie stammeln und verheddern sich. Aber ihre Worte erzeugen ein Echo.
Wir können es hören: Jetzt.
So oder so ähnlich erzählt es die Bibel in der Apostelgeschichte
aus: Fernseh-Wohnzimmerkirche zu Pfingsten in der ARD. Kann man hier nachschauen:
https://www.ardmediathek.de/video/gottesdienst/pfingstgottesdienst-ueber-den-ur-schall/das-erste/
Sonntagsgebet

Du im Himmel,
wir wollen keinen Krieg
statt Panzer wollen wir Pfirsichblüten
wir wollen Geld ausgeben für Kinder
Armut ist ein tristes Kleid
Wir wollen kein Hochwasser
und keine Erdbeeren im März
die Erde liebhaben wollen wir
Wir wollen keine Schmerzen
aber wenn sie da sind
wollen wir Hände die uns halten
und niemand fällt heraus
Wir wollen gerechte Renten
und geteilte Träume
Wir wollen Leben
das nach Zukunft schmeckt
Leinenweiß

Ich nehme die Schuld
und lege sie in ein Bett
aus gestärkten Leinen.
Schlaf, sage ich,
die Nacht singt dir ihr Wiegenlied.
Ich bleibe drei Atemzüge,
dann gehe ich durch die Schwärze davon.
Der Mond geht unter.
Die Luft wird leicht.
Am Horizont das Licht.
Die Schuld träumt
einen zarten Traum.
Am Morgen ist sie verwandelt,
weiß der Himmel wie.
Non. Nein. Nö.

Heute Morgen höre ich eine Andacht anlässlich des „Frauenkampftages“, so nennt die Pastorin ihn und beginnt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Nö. Nö, ich möchte keinen Gott mehr in einseitig patriarchaler Sprache feiern. Auch nicht aus Traditionsgründen. Es gab auch mal die Tradition, Hexen zu verbrennen, Kinder zu schlagen und Hunde in Deiche einzubuddeln, um den Geist der Sturmflut zu besänftigen. Man muss nicht jede Tradition von Ewigkeit zu Ewigkeit schleppen.
Frauen sind ja nicht diese seltene Spezies, sondern mehr als die Hälfte der Menschheit. Angeblich hat Gott diese Menschheit nach dem eigenen Ebenbild geschaffen. Also wohnen in Gott alle Facetten des Menschseins. Warum beschränken die meisten Kirchenmenschen Gott auch im Jahr 2024 auf eine einzige, nämlich den Vater?
Nö, ich möchte Weiblichkeit auch nicht mitgemeint denken. Wer einen so kleinen Wortschatz hat, wer keine weiteren Bilder von Gott findet, ist kein Traditionalist, keine Traditionalistin, sondern phantasielos oder denkfaul. Was für ein armes Bild, wenn Gott eine so übergroße Männlichkeit bräuchte, um zu existieren. Sprache schafft Wirklichkeit: Wenn Gott eine Weltgeschichte lang männlich gepredigt wird, werden Männer vergöttert. So geschehen in den Zeiten des Patriachats. Männer lernen von Kindesbeinen, breitbeinig zu stehen. Frauen müssen das üben.
Ich stehe hier nicht im Namen eines Vaters, Sohnes und wenn es gut läuft einer weiblich angehauchten Geistkraft. Ich stehe hier im Namen einer Kraft, die uns Denken, Fühlen, Entscheiden lässt.
Nö, ich will den Vater, Herrn, Herrscher, König, den Allmächtigen nicht verbieten. Wer Gott weiterhin einseitig männlich feiern will, möge das tun. Ich gehe einfach auf eine andere Party. Adios.
Wohnzimmerkirche "Non. Nein. Nö" vom 8. März
Und. ein Hoch auf die Gleichzeitigkeit

Ich stelle mir vor: ein Tag, an dem alle anziehen, wovon sie insgeheim träumen. Wie Karneval, nur in echt. Sibylle zum Beispiel trägt ein Kleid aus 943 Federn, die hat sie alle eigenhändig angenäht. Weil sie sich mal wie ein Vogel fühlen will. Paul trägt Pailletten zum Blaumann. Igor trägt wie immer Jeans und Wollpullover, weil er sich darin am allerwohlsten fühlt und zutiefst Igor ist. Frau Piepental hat ihren Petticoat rausgeholt und niemand sagt: Na wissen Sie, in Ihrem Alter…
Es gibt Könige und Draufgängerinnen, es gibt Nietenhosen und Zweireiher, Kopftücher und Knickerbocker, es gibt grau und rosa. Es gibt Kippa und Krawatte, und Josef steht in seinem Prinzessinnenkleid dazwischen und fällt überhaupt nicht auf, weil er dazugehört. So wie alle dazugehören. Und nein, es geht nicht darum, wer am grellsten leuchtet. Es geht einfach nur ums Sein. Und niemand haut das eigene Sein anderen um die Ohren.
Und Gott schaut sich das an und findet es gut. Das glaube ich zumindest, auch wenn ich es natürlich nicht weiß. Kein Mensch weiß, was Gott denkt, sagt, will, tut. Ich stelle mir vor, wie Gott zwischen all den bunten Menschen steht und sich verbeugt. Das irritiert, also passt es zu Gott. Gott irritiert oft.
Ein paar Leute machen es nach. Sibylle verbeugt sich vor dem Knickerbockerträger, Igor verbeugt sich vor einem kleinen Mädchen mit Hut. Ein Punk verbeugt sich vor Oma Grete, eine Polizistin verbeugt sich vor einer Linksalternativen und umgekehrt, ein Golden Retriever verbeugt sich vor einer misstrauischen Katze.
Einfach aus Respekt vor seinem oder ihrem Sein. Auch vor ihrem Anders-Sein. Eine Verbeugung ist eine kurze Geste. Wer in ihr verharrt, buckelt. Darum geht es nicht. Sondern darum, einander groß zu machen. Wechselseitig und abwechselnd. Anzuerkennen: Du bist anders. Ich bin anders. Und wir gehören als Menschen trotzdem zusammen. Wir werden einen Weg finden, nebeneinander zu leben, ohne einander in den Schatten zu stellen.
Januar

Im goldenen Licht eines Januarnachmittags
bin ich über den See geglitten
und habe Spuren gesehen
von Elch und Hase und Fuchs
und von etwas tapsig Kleinem.
Aber Elch und Hase und Fuchs
habe ich nicht gesehen,
auch keinen Taps gehört.
Trotzdem sind sie da.
Was könnte alles noch da sein,
das ich nicht sehe?
Was könnte alles drin sein
in diesem weißen Jahr?
Auf Anfang

Stell dir vor:
In dieser Nacht setzt dir jemand eine Krone auf.
Weil du es bist.
Weil du immer noch suchst.
Nimm das Wertvollste, das du hast.
Nenn es Sehnsucht. Oder Liebeshunger. Oder Wissensdurst.
Du bist nicht fertig.
Stell dir vor:
In dieser Nacht setzt dir jemand eine Krone auf.
Weil du es bist.
Du wirst sieben Zentimeter größer.
Du wächst in dich hinein
und über dich hinaus.
Dein Glanz legt sich auf müde Gesichter im Bus.
Erhellt die Fischfrau auf dem Markt.
Ist ein Lichtblick für irgendwen.
Du berührst.
Stell dir vor:
In dieser Nacht setzt dir jemand eine Krone auf.
Sagt: Greif nach einem Strohhalm
und geh los.
Da draußen wird ein Anfang geboren.
Du wirst ihn finden
zwischen den Räumen.
Du wirst ihn finden
stolpernd unter einem Stein.
Du wirst ihn finden
in einem sternklaren Augenblick.
Da draußen wird ein Anfang geboren.
Nimm ihn zu Herzen. Füttere ihn. Bring ihn zur Welt.
Wohnzimerkirche "Auf Anfang". 15. Dezember 2023
Möglichkeitsräume

Der Tag ist noch nicht zu Ende. Ein paar Stunden haben wir noch und was könnte in diesen Stunden alles geschehen! Und damit meine ich nicht die fürchterlichen Dinge. Ich meine keine weiteren Katastrophen, keine neuen Tragödien. Ebenso wäre es doch möglich, dass genau jetzt irgendwo auf der Welt etwas Wunderbares passiert. Und wenn nicht jetzt, dann vielleicht in einer halben Stunde. Wir brauchen Möglichkeitsräume. Das sind Räume, in denen alles drin ist. Innere Räume, in die man hineingehen kann und sich vorstellt, was noch nicht ist, aber sein könnte: Zum Beispiel könnte heute Abend Wladimirs Herz warm und laut sein, und er stoppt einen Krieg. Der Papst könnte seine Verlobung mit Alfonso bekannt geben und die ganze Kurie feiert Junggesellenabschied. In seinem unergründlichen Ratschluss könnte Gott alle SUVs in Lastenfahrräder verwandeln. Eine rechtsextreme Partei könnte einen Ausflug ins Bällebad machen und nie wieder auftauchen. Irgendwo auf der Welt könnte sich ein Wunsch erfüllen, könnte jemand sagen: Ich habe mich geirrt, könnte ein Topf Basilikum überleben. Irgendwo auf der Welt könnte Frieden beginnen, in einem Hinterzimmer, bei einer Verhandlung, an einem Küchentisch. Es wäre möglich. Vielleicht genau jetzt.
Gleichzeitig

Alles hat seine Zeit
Nachrichten hören
Playlist auf laut stellen
Widersprechen
lernen, was ich nicht weiß
Mitgefühl zeigen
den Kopf in ein Kaninchenfell vergraben
#erntedank

Jesus streift durch die Felder und lässt seine Hand durch die Ähren gleiten. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt und wonach es riecht: nach Staub und frischem Brot und nach zuende gehendem Sommer. Die Sonne steht tief, es ist Nachmittag und das Licht färbt seine Haut golden. Ich frage mich, ob ich genauso glänze wie er. Manchmal rauft er eine Ähre und pult die Körner raus. „Karge Ernte“, sage ich und wundere mich, denn es ist nicht sein Feld und nicht er war es, der gesät hat. Er schüttelte den Kopf. „Ich ernte nicht“, sagt er, während er auf einem Korn knabbert. „Ich habe keine Scheune, nicht mal einen Küchenschrank, in dem ich das Mehl lagern könnte. Ich habe nichts.“ Ich will widersprechen, will sagen: „Du hast eine Menge: Freunde und Unterstützerinnen, du hast Mut und Vertrauen, mehr als jeder Küchenschrank fassen könnte.“ Aber bevor ich den Mund öffne, schüttelt er den Kopf. „Ich möchte nichts haben“, sagt er leise und bestimmt. „Ich möchte leben und lieben, nehmen und geben, ich möchte mich verschwenden. Ich möchte sähen, während ich weitergehe, unterwegs möchte ich einer Blume Wasser geben und einem hungrigen Huhn ein paar Körner hinwerfen. Ich möchte teilen, was ich nicht besitze. Ich möchte Wörter sammeln und sie mir eine Zeitlang auf die Zunge legen, bevor ich sie an anderer Stelle wieder fallenlasse. Ich möchte mir etwas zu Herzen nehmen, ohne es festzuhalten.“ Seine Sätze berühren mich, sie sind so schlicht, ich will sie unbedingt behalten, da vibriert mein Handy und lenkt mich kurz ab. Eine Push-Up-Nachricht meldet fallende Aktienkurse. Ständig bekomme ich solche wichtigen Mitteilungen, ich weiß nicht, wie man die ausschaltet. Ich müsste es recherchieren, genau wie ich mehr über Aktien wissen müsste, wegen der Rente und auch, um mitreden zu können. Als ich das Handy wieder wegstecke, ist die Sonne hinterm Horizont verschwunden. Und auch der Glanz. Ich merke, dass ich Hunger habe. Jesus kramt in seinen Taschen und fischt eine halbe Tüte Salzlakritz heraus. Ich stecke mir zwei in den Mund, obwohl ich kein Lakritz mag. Aber in regelmäßigen Abständen probiere ich sie wieder, Vorlieben ändern sich. Früher konnte ich nicht genug von Bifi bekommen, das ist so eine Minisalami in Plastikhaut. Heute verursacht mir allein schon der Geruch Übelkeit. „Gut“, sagt Jesus, „dass du keinen Vorrat angelegt hast.“
Poolparty

Im Süden ist es heiß und trocken, die einen kleben auf der Straße fest, die anderen preisen, dass es mal wieder richtig Sommer ist. Ein Sommer, in dem man den Pool im Garten füllen kann und Schirmchen ins Cocktailglas steckt. Was man nicht ändern kann, muss man feiern. „Ihr könnt was ändern“, ruft Jesus, aber die Musik spielt anderswo und Jesus ist sowieso ein Spielverderber. Immer wenn man gerade Spaß hat, erinnert er an die anderen, die keinen Spaß oder keinen Pool haben, erinnert er an die, für die Wasser kein Freizeitvergnügen, sondern Überleben bedeutet. Alle gähnen, jetzt kommt die Predigt. „Lass es halt regnen“, ruft einer und der Rest johlt, „du bist doch Profi in Sachen Wunder!“ Eh klar, dass niemand an diese Geschichten mehr glaubt. Wunder sind keine sichere Bank. Das ist unbequem, weil man bis zum nächsten Wunder doch wieder selbst ran muss, um die Welt zu retten. Dabei ist es schon anstrengend genug, das Gefühl der eigenen Ohnmacht nicht an die Oberfläche zu lassen. Ohnmacht ist ein Eisberg, was man sieht, ist nur die Spitze, aber das Eis schmilzt ja sowieso gerade, was soll’s also – lasst uns feiern und den Sommer genießen. Und überhaupt: war da nicht was, verwandelt Jesus selbst nicht Wasser in Wein, warum dann nicht gleich in einen Wildberry Lillet?
Aber Jesus hat sich aus dem Staub gemacht, wahrscheinlich reicht er das Wasser gerade den Klimakleber*innen, auf dem Asphalt ist es heiß. Die nerven, Jesus nervt, dass entweder Waldbrandgefahr oder Überschwemmung ist, nervt auch.
Ich verlasse die Party und beschließe, ins Freibad zu gehen, da dürfen wenigstens alle rein. Das Wasser ist kalt, kälter als gedacht. Ich sitze am Rand und stippe die Zehen ins Becken, da sehe ich Jesus übers Wasser kommen. Er hält ein selbstgemaltes Plakat in der Hand: „Heute schon an die Party von Morgen denken: Save the planet.“ Die Leute schwimmen einen großen Bogen um ihn, als sei er ein Gespenst, ganz allein steht er in der Mitte der Wasserfläche. Fast könnte er einem leidtun. „Komm“, ruft er. Ich hätte mich gern weggeduckt, doch er hat gesehen, dass ich ihn sehe. „Ich kann nicht“, sage ich. „Dann schwimm halt. Oder willst du wirklich, dass die Welt baden geht?“ Natürlich nicht. Also stehe ich auf, nehme Anlauf und springe rein ins kalte Wasser. Direkt vom Beckenrand. Obwohl das doch verboten ist.
Wie ich mal fast (aber nur fast) reich geworden wäre
„Guten Tag“, sagte der Herr im Blockstreifenanzug, „darf ich mich vorstellen? Wir kennen uns noch nicht. Ich bin ab heute ihr persönlicher Engel, Abteilung strategische Lebensplanung und Anlageberatung. Ich bin ganz für Sie da.“
„Wir siezen uns?“
„Das gehört zu unserer neuen Strategie. Unsere Zielgruppenanalyse hat ergeben, dass Engel nicht mehr ernst genommen werden. Da möchten wir gegensteuern.“
„Aha.“
„Ich habe eine Weiterbildung zum Vermögensberater abgeschlossen.“
„Ach. Von welcher Art Vermögen reden wir?“
„Ich bin spezialisiert auf Vertrauensvorschüsse, Glücksdepots und japanische Aktienfons.“
„Interessant…“
„Nicht? Wie reich möchten Sie denn werden?“
„Das kann ich mir aussuchen?“
„Als Engel performen wir mit Skills, die über die eines gewöhnlichen Bankberaters hinausgehen.“
„Erstaunlich.“
„Sie sagen es. Wenn das nur mehr so sehen würden.“
„Was unterscheidet Ihr Institut denn von gewöhnlichen Banken?“
„Im Grunde nichts mehr. Wir betreiben natürlich Traditionspflege. Unsere Geschäftspapiere ziert das Wasserzeichen „Glaube, Liebe. Hoffnung“. Dezent, aber wirkungsvoll. Unsere Marketingabteilung nutzt eingeführte weiche Bilder wie Himmel, Regenbogen, etcetera. Und dann haben wir natürlich starke Identifikationsfiguren…“
„Sie meinen Jesus?“
„Zum Beispiel.“
„War der nicht gegen Reichtum?“
„Denkt man immer, aber auch Jesus verfügte über ein beträchtliches Vermögen, verteilt auf diverse römische Banken.“
„Sie scherzen.“
„Mitnichten. Denken Sie an den Schatz im Acker. Ein älterer Kollege von mir war sein persönlicher Anlageberater.“
„Ich glaube, Sie erfinden das gerade. Ich habe noch nie von Engeln wie Ihnen gehört. Eigentlich will ich auch gar nicht, dass es solche Engel gibt.“
Die Blockstreifen wellen sich, und mein Gegenüber löst sich in Spielzeuggeld auf, das der Wind in alle vier Himmelsrichtungen verteilt, bis die Luft wieder rein ist.
Tja.
Wieder nix.
Laufende Liste

Ich mag Freiheit. Ich mag, dass auf der Straße ein Klavier steht.
Ich mag keine Musik, die mich nervt. Jazz zum Beispiel.
Ich mag keine Pauschalisierungen. Ich mag Menschen,
die eine Haltung haben und sie begründen können.
Ich mag Menschen, die gelenkig genug sind, ihre Haltung zu ändern.
Ich mag Yoga. Ich mag Selbstironie.Ich mag es nicht,
wenn zu viel erwartbar ist. Ich mag Listen.
Ich mag kleine Häkchen, die mir zeigen, dass ich schon viel geschafft habe.
Ich mag es nicht, zu prokrastinieren. Manchmal tue ich es trotzdem,
weil ich das Kribbeln mag, wenn es eng wird. Ich mag Kirchentagsschals.
Ich werde nie einen tragen. Ich mag Widersprüche.
Ich mag Eis im Allgemeinen. Außer Nuss. Und Banane. Ich mag das Gefühl von Danach
und das Gefühl von Davor. Gerade bin ich genau dazwischen.
(to be continued)
Konfetti für alle!

Als Gott die Welt auf den Kopf stellt, öffnet sie den Himmel und ruft: "Hereinspaziert, hereinspaziert!"
Als erstes kommen die Zweifler um die Ecke und können es nicht glauben: "Echt jetzt, Himmel für alle, einfach so? Gibt’s denn sowas?"
Und Gott sagt: "Wenn ihr dran glaubt, dann gibt es das."
Und sie wirft 5 Hände Regenbogenkonfetti und verschenkt ein Lächeln, das einfach bezaubernd ist.
"He", rufen da welche. "So geht das aber nicht. Erst sind wir dran. Schließlich waren wir jeden Sonntag in der Kirche. Morgens um 10. Ohne Frühstück! Wenn die da 5 Hände Konfetti kriegen, verdienen wir 10! Und doppelten Zauber, mindestens."
Gott ist ein bisschen ratlos, weil Zauber plus Zauber ist Zauber, und Himmel plus Himmel ist immernoch Himmel.
"Moooooment", rufen da noch andere, "nicht so schnell! Wir waren schließlich von Anfang an dabei. Wir beten seit 27 eineinhalb Jahren morgens, abends und mittwochs sogar mittags. Wir haben die Bibel einmal von vorn und einmal von hinten gelesen. Und wir waren auf jedem Kirchentag. Wenn jemand als erstes in den Himmel kommt, dann jawohl wir! Die anderen, die müssen erstmal nachsitzen: 100 Vater Unser und einmal Pilgern auf dem Jakobsweg!"
Es wird sehr laut am Himmelstor, es donnern die Stimmen, es fliegen die Funken, so dass selbst die Engel sich die Ohren zuhalten und sich wundern. Der Himmel ist doch so groß, so unendlich groß.
"Beruhigt euch", ruft Gott, "es gibt Platz genug für alle! Für die Zweiflerinnen und für die Frommen, und ihre 1000 Gebete passen auch mit rein. Für die mit dem klitzekleinen Glauben und selbst für die Schurken gibt es irgendwo ein Plätzchen (aber nicht ganz vorn, das dann doch nicht)."
"Das ist ungerecht", schreien die Frommen. "Wozu haben wir denn unser ganzes Leben gebetet?"
"Wozu habt ihr geküsst?
Wozu habt ihr Regenbögen bewundert?
Wozu eure Nasen in den Wind gehalten?
Wozu habt ihr in Sommernächten ins Feuer geschaut?
Wozu die Katze des Nachbarn gekrault?
Weil es schön ist. Einfach, weil es schön ist.
Hereinspaziert!
Die Letzten sollen auch mal die ersten sein, die Langsamen nach vorn, und ein Mohnblütenteppich für die Verzagten.
Wer nichts zu bieten hat, braucht alles das doppelt so sehr. Kein Neid, hereinspaziert, der Himmel ist groß, Konfetti für alle!"
Gott mit Sternchen. Wie wollen wir reden?

Als Gott mir vorgestellt wurde, war ich 14. Vorher hatte ich schon manchmal von ihm gehört – und ja, ich sage „ihm“, denn Gott war ein Herr. Ein bisschen aus der Zeit gefallen, so wie Herr Busche von nebenan, der sein Geld als Klavierlehrer verdiente und aus dessen Wohnung manchmal schwer zugängliche Musik kam. Herr Busche trug immer einen Hut und sprach nicht viel. Ich grüßte ihn schüchtern und irgendwie auch ehrfurchtsvoll, denn er war ganz anders als mein Vater, der am liebsten Blasmusik hörte und auch gegen Schunkeln nichts einzuwenden hatte.
Gott schunkelte nicht. Er hatte genug damit zu tun, die Welt in Gut und Böse zu teilen und vorwurfsvoll zu gucken wegen der Sache mit seinem Sohn, auf den wir nicht genug aufgepasst hatten.
Das war sehr anstrengend, und als ich erwachsen genug war, sagte ich, ich bräuchte mal ein bisschen Abstand und das Überraschende war: Gott nickte und sagte „ich auch“. Und dann löste Gott sich auf und tauchte später an ganz anderer Stelle wieder auf, und es begann eine neue Geschichte.
Doch bis dahin sollte es dauern. Zunächst lernte ich, mitgemeint zu sein. Wenn der Pastor „Liebe Brüder“ sagte. Pastorinnen gab es nicht, jedenfalls nicht in der evangelischen Landeskirche da, wo ich aufwuchs. Frauen und Männer seien gleichwertig aber nicht gleichartig, hieß es. Enten bauten ja auch keine Biberdämme und Frauen gehören nicht auf die Kanzel. Dieser Satz brannte sich mir ein, ich stand ihm mit meinen 15 oder 16 Jahren ohnmächtig gegenüber. Als würde mich ein Biologielehrer einer bedrohten Art zuordnen, die es zu erhalten galt. Eine Art, die er und seine Kollegen eingehend studiert hatten. Welche Fähigkeiten sie hat, in welchem Habitat sie sich wohlfühlt, das definierten Männer...
Und auch Frau Engelking, die die Kinderkirche leitete und uns Helferinnen beibrachte, wie man Kindern von Gott erzählt: Als Vater, der alle liebhat, aber auch streng ist. Wenn man nicht tut, was er will, wird er böse. Siehe Sintflut. Den Kindergottesdienst durften Frauen leiten, im Gegensatz zu richtigen Gottesdiensten. Weil Frauen einen natürlichen Draht zu Kindern haben, artgerecht sozusagen.
Das alles fand nicht in den Fünfzigern statt, sondern in den 1980er-Jahren. Wo die Infohefte des Arbeitsberaters, der in unsere Schule kam, bereits genderten. Es gab Informatiker und Informatikerinnen, Köchinnen und Köche, Theaterwissenschaftlerinnen und Theaterwissenschaftler. Theoretisch konnte ich alles werden. Nur nicht Pastorin.
Wollte ich auch nicht. Aber dass Gott das angeblich aus Prinzip auch nicht wollte – das nahm ich ihm krumm.
Es ist schwierig, mit Gott zu diskutieren. Mit Menschen geht das theoretisch besser. Allerdings begegne ich immer wieder Menschen, die sehr genau darüber Bescheid wissen, wie Gott denkt und was Gott will. Das wundert mich. Woher wissen sie das?Über 2000 Jahre wurde die Geschichte des christlichen Gottes überwiegend von Männern erzählt. Sie waren lauter. In einer patriarchalen Gesellschaft kein Wunder. Dass es dabei viel um Macht und nicht bloß um Erleuchtung ging, ist bekannt.
Ein schönes Beispiel ist Junia. In der Bibel schreibt Paulus über sie und einen gewissen Andronikus: „Sie sind herausragend unter den Aposteln und haben sich schon vor mir zu Christus bekannt.“
Eine Frau als Apostel? Auch Johannes Chrysostomus, im vierten Jahrhundert Bischof von Konstantinopel, hebt das besonders hervor: „Ein Apostel zu sein ist etwas Großes. Aber berühmt unter den Aposteln – bedenke, welch großes Lob das ist. Wie groß muss die Weisheit dieser Frau gewesen sein.“
Bis heute lehnt die katholische Kirche das Priestertum von Frauen ab, unter anderem mit der Begründung, es habe keine Apostelinnen gegeben. Und tatsächlich verschwand Junia im Lauf der Geschichte. Oder sagen wir, sie wechselte das Geschlecht. Allerdings nicht freiwillig. Man hängte einfach ein „S“ an ihren Namen. Aus Junia wurde Junias. Sie wurde zum Mann. Zum ersten Mal taucht Junias nachweislich im 13. Jahrhundert auf – bei Ägidius von Rom, einem Schüler des Kirchenlehrers Thomas von Aquin. Nicht gerade als Feminist bekannt. Martin Luther übernahm das. Dabei gibt es den Name Junias in der antiken Literatur sonst nicht, während Junia ein verbreiteter Frauenname war.
Und Junia ist kein Einzelfall. Auch Maria von Magdala wurde über ein Jahrtausend Apostelin unter den Aposteln genannt. Sie war die erste, die dem auferstandenen Jesus begegnete. Und sie wurde verehrt deswegen. Spätantike Texte belegen das.
Im Mittelalter wurde aus ihr eine Sünderin, eine Prostituierte, bis ihr Ruf nachhaltig beschädigt war.
Es ist gar nicht so, dass es im biblisch-frühchristlichen Universum keine Frauen gab. Sie wurden nur mundtot gemacht. Blöd, wenn frau nach Identifikationsfiguren sucht.
Seit 2016 steht in der Einheitsübersetzung übrigens wieder Junia, seit 2017 auch in der Lutherbibel.
Die Bibel erzählt durchaus in verschiedenen Perspektiven von Gott. Überwiegend männlich, weil von Männern geschrieben. Im Buch des Propheten Hosea sagt Gott über sich selbst:
„Ich bin Gott und kein Mensch, ich bin heilig in deiner Mitte .“ Und im 2. Buch Mose antwortet Gott auf die Frage nach dem Namen: „Ich-bin-da.“ Oder einfach „Ich-bin.“ Kein Mann, keine Frau, kein Mensch.
Als ich das zum ersten Mal las, begann eine neue Geschichte.
Eine, die Gott frei lässt. Die Gott nicht unter einen Hut mit Männern steckt. Die Kategorie männlich (genau wie weiblich) beinhaltet so viele Zuschreibungen, die Gott und Menschen festnageln.
Kleiner Exkurs:
Ich bin ein Mensch. Im Körper einer Frau. Ich kann gut zuhören, aber nicht nähen. Ich mache gern Feuer, finde Röcke angenehmer als Hosen und mochte rosa schon, bevor es Prinzessin Lillifee trug. Ich habe keine Kinder geboren und bin glücklich damit. Ich fahre gern Auto, genieße es manchmal, mich anzulehnen und gehe an anderen Tagen vorweg. Ich hasse es, mein Fahrrad zu flicken und freue mich, wenn jemand Spinnen aus dem Weg räumt. Eine Maus würde ich aber jederzeit auf die Hand nehmen. Manchmal bin ich härter als ich will. Ich koche täglich, eine Bratpfanne auf dem Geburtstagstisch wäre für mich keine Beleidigung. Fußballübertragungen langweilen mich, Fashionfragen auch. Ich habe eine Vulva und finde das gut, allerdings habe ich auch keinen Vergleich, wie es mit einem Penis wäre (etwas unpraktischer stelle ich es mir vor).
Was ich damit sagen will: Die Frage, ob ich mich weiblich fühle, spielt für meine Identität keine große Rolle. Ich bin ich. Ich fühle mich gut (jedenfalls im Großen und Ganzen). Und ich möchte in einer Welt leben, in der das jede und jeder von sich sagen kann. In der Menschen dieselben Rechte haben. Einen Rock tragen dürfen und einen Bart. An manchen Tagen zartbesaitet sind, an anderen gestählt. Alle Zeit der Welt mit Kindern verbringen dürfen, ohne sich dafür entschuldigen zu müssen. Oder mit einem Floß den Mississippi queren dürfen oder glücklich hinter Aktenordnern verschwinden. Mit Hüftschwung durch die Straßen gehen oder mit Stiernacken. Und das alles sollte keine Frage des Geschlechts sein, sondern der Sehnsucht: Wer bin ich? Was entspricht mir?
Ich möchte in einer Welt leben, in der es weniger Kategorien gibt und mehr Sein.
Ich bin. Ich bin da.
Gott: ist kein Mensch. Trotzdem brauche ich manchmal Bilder von Gott. Ich brauche Geschichten, die Gott auf die Erde holen. Die davon erzählen, wie andere Gott erleben. Wenn eine Geschichte konkret sein soll, dann kann sie nicht alles offen lassen. Sie malt Bilder in meinem Kopf und in meinem Herz. Ich habe also nichts dagegen, die Geschichte vom Verlorenen Sohn zu hören und kann mich mit ihm identifizieren, obwohl er als Mann beschrieben wird. Allerdings spricht auch nichts dagegen, diese Geschichte als Geschichte einer Tochter zu erzählen. Es handelt sich ja um ein Gleichnis und nicht um eine historische Begebenheit. Es geht nicht um die einzelne Person, nicht um die einzelne Geschichte, sondern um das große Ganze. Und in dem ist es eben so: wenn nichts von Töchtern erzählt wird, dann werden sie auch im tatsächlichen Leben eine untergeordnete Rolle spielen. Sprache bildet Wirklichkeit nicht nur ab – sie schafft auch Wirklichkeit. Das ist ihr Zauber. Und Zauberei kann beides: etwas verschwinden oder etwas erscheinen lassen. Mit den Geschichten, die wir erzählen, entscheiden wir, ob wir eine einfältige oder eine diverse Welt abbilden.
Wenn wir Gott in Geschichten immer wieder darauf reduzieren, Herr oder Vater zu sein, dann machen wir Gott klein. Dann zäunen wir Gott ein. Dann ist das so, als würden wir zu nah an ein unfassbar großes, buntes Mosaik herantreten und nur einen winzigen Ausschnitt betrachten. Und anschließend behaupten, das sei das ganze Bild.
Es ist aber nicht das ganze Bild. Die Erfahrungen, Beschreibungen, Gleichnisse, die Möglichkeiten, von Gott zu erzählen - sie sind so unendlich wie das Universum.
Deshalb lohnt es sich, weiter zu denken und nach den Sternen zu greifen. Auch nach dem Gendersternchen. Nicht um es anderen an den Kopf zu werfen. Nicht als neues Dogma. Sondern um die Sprache zu weiten. Damit wir die Galerie der Bilder Gottes um neue Ansichten erweitern. Damit wir Gott frei lassen, denn Freiheit ist das allererste Gebot: „Ich bin dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. “ Auch aus der Sklaverei einseitiger Bilder und einseitiger Sprache.
Den Herrn mit Hut sehe ich heute manchmal von ferne. Er kommt mir genauso einsam vor, wie damals der alte Herr Busche. Es kann aber auch sein, dass es meine eigene Einsamkeit ist, die ich fühle. Wir haben so wenig gemeinsam. Wie er wohl aussieht, frage ich mich, wenn er den Hut ablegt und die ganze Herrlichkeit dazu?
Auch an Junia und Maria denke ich oft…
Bis ich sie zufällig treffe. In einer Bar, sie sind nicht allein. Sie reden und gestikulieren, zusammen mit vielen anderen feiern sie das Leben. Lachen kommt aus ihrer Ecke, ein freies, kein hämisches Lachen. Ich gehe zu ihnen und spreche sie an, ob sie nicht wütend sind, ob sie nicht kämpfen wollen. „Ach, Wut“, sagen sie. Die haben sie hinter sich. Sie wollen sich nicht mehr abarbeiten an jenen, die Angst haben um Macht und Bedeutung. Sie machen einfach ihr eigenes Ding. Der Herr mit dem Hut sei ohnehin nur eine Projektion, eine Herrschaftsphantasie. Sogar Gott selbst sei seiner müde. Woher sie das wissen, frage ich überrascht. Wissen können sie es natürlich nicht, geben Junia und Maria beide zu. Auch sie nicht, obwohl sie so nah dran waren. „Aber wir können entscheiden, was wir glauben.“
Ich bleibe eine Weile bei ihnen sitzen, es ist so hell und offen in ihrem Kreis, etwas funkelt. Das habe ich lange schon vermisst. Über ihren Köpfen flackern die Lichter in einer Million Farben, und ich wundere mich, mit wem sie alles Umgang pflegen. Selbst Paulus schaut vorbei, Luther und Katharina wagen ein Tänzchen und sind ganz aufgeräumt. „Warum wundert dich das“, rufen sie mir zu. „Alles ändert sich, Sprache sowieso, da sind wir ganz vorn. Wir sind ja nicht mehr im Mittelalter…“ Der Rest geht unter im Stimmengewirr, ich bleibe, ich feiere bis in den Morgen. Später, draußen beim Gehen, fällt mein Blick auf das Leuchtschild über der Tür. „Irgendwas wie Kirche“, steht da. Ich lächele. Wer nennt denn so eine Bar?
Am Sonntagmorgen, Deutschlandfunk. Hier zum Nachhören.
86 400 Sekunden

Stell dir vor: Am Morgen der Welt verschenkt Gott Lebenszeit.
Für jeden Mensch, für jedes Tier, für Olga und Ahab, für die Saurier und die Anemonen, für das Faultier und den Mammutbaum. Lässt regnen so viel Leben, so viel Glück.
Moment, rufen da plötzlich welche. Das ist gar nicht gleichverteilt. Die einen bekommen mehr, die anderen weniger.
Das ist ja total ungerecht!
Und das stimmt. Es ist fürchterlich ungerecht. Die einen haben viel Lebenszeit und die anderen viel zu wenig. Es gibt kein erkennbares System. Als ob sich jemand verrechnet hätte.
Und Gott – schweigt. Wie eine Künstlerin, die ihr Werk nicht erklären will.
Und das Glück? Das ist trotzdem da. Weil Glück nicht rechnet. Glück braucht nicht viel Platz. Glück lässt sich nicht einschüchtern.
Also noch mal von vorn, eine Nummer kleiner:
Am Morgen jedes Tages verschenkt Gott Lebenszeit. Für jeden Mensch, für jedes Tier, für Olga und Ahab, für die Nachkommen der Saurier und für die Anemonen, für das Faultier und den Mammutbaum. Für dich, für mich. Hier, flüstert Gott. Macht was draus.
Die einen machen Picknick, leihen sich ein Pferd, schreiben einen halben Roman, stricken einen krummen Schal, lernen Minigolf, lösen fünf Kreuzworträtsel und eine Gleichung mit vier Unbekannten, teilen einen Schokokuss und schlafen 9,3 Stunden. Sie setzen alles auf diesen Tag.
Andere sind vorsichtiger. Sie halten sich zurück, denn sie wollen die Zeit gut einteilen. Das Spielen verschieben sie auf später, das Picknick verlegen sie an den Küchentisch und schlafen müssen sie ja sowieso. Wenn auch nicht ganz so lang.
Und schließlich gibt es welche, die wollen die Zeit aufsparen. Für etwas Besonders, wer weiß, was noch kommt. Eines Tages, sagen sie. Eines Tages gönne ich mir wirklich was. Die einen sind glücklich. Die anderen sind mittelglücklich. Und die letzten sind gar nicht glücklich.
Und wieder ruft jemand: Das ist ja total ungerecht!
Aber diesmal schüttelt Gott den Kopf: Ihr alle bekommt 24 Stunden mal 60 Minuten mal 60 Sekunden. 86 400 Sekunden Leben. Tag für Tag neu. Und mindestens ein paar davon werden glücken. Macht was draus!
Hütchenspieler

Als Jesus überraschend seine Kirchenmitgliedschaft kündigt, wirft Erna Kozlowski den Staublappen hin. 37 Jahre hat sie den Altar abgestaubt und die Kaugummis der Konfirmanden von den Bänken gepult. Alles für den Herrn Jesus. Aber wenn der feine Herr jetzt zum Dank das Weite sucht, kann sie das auch. Dann macht sie Urlaub auf Mallorca, da träumt sie schon ihren Lebtag von, aber wer nur montags bis samstags Zeit habt, kommt höchstens bis Meschede im Sauerland.
In der Kirche wird es still. Der Organist ist schon vergangenen Herbst an multiplem Organversagen verschieden, und die letzte Konfirmandin meldet sich ab, weil sie jetzt selbst Influencerin ist. Jesus hat das kommen sehen, der Öffentlichkeitsbeauftragte hat ihm dennoch den Insta-Zugang verweigert und stattdessen eine Neuauflage der Bibel in poppigem Pink angeregt. Jesus wirft ein paar Tische um, auch Tastaturen fliegen durch die Luft, eine Mediatorin wird einbestellt, und man gründet nach siebzehn-monatigem Findungsprozess die Stabsstelle Kommunikation, für die sich Jesus aufgrund mangelnder Qualifikation als ungeeignet erweist. Er wird zornig, sehr zornig, und nach dem Zorn kommt die Gleichgültigkeit und was dann kommt, verfolgt niemand mehr.
Aus der Kirche wird ein Zentrum für Zukunftsprozesse. Es erhält einige lobende Erwähnung für energieeffizientes Heizen.
Die Bibel wird auch in Türkis gedruckt.
Erna Kozlowski nimmt eine Stelle als Facility-Managerin in der Filiale einer Imbiss-Kette an. Es heißt, dort träfe sie Jesus öfter umringt von einer beachtlichen Gruppe Neugieriger, er habe erstaunliche Tricks auf Lager, wie ein Hütchenspieler. Aber das kann sich niemand recht vorstellen, so tief würde doch selbst Jesus nicht sinken. Die Pommes aber seien tatsächlich besser als gedacht.
Du im Himmel

Du im Himmel
und unter der Haut
Dein Name ist heilig
deine Wunderwelt komme
Dein Wille geschehe
oben und unten und überall
Gib uns heute, was wir brauchen
Vergib uns
und auch wir vergeben
Sei bei uns, wenn wir uns verlieren
und erlöse uns
Denn du bist Ein und Alles
Kraft und Herrlichkeit und Ewigkeit
Ich suche immer wieder nach Worten, die passen. Zusammen mit Matthias Lemme ist diese Variante des Vater Unsers entstanden.
In der Tradition gibt es Texte, die sind zu eng geworden. In meinem Viertel gibt es einen phantastischen Änderungsschneider. Er hat schon Hosen kürzer gemacht, Reißverschlüsse repariert, einen mottenzerfressenen Schal gestopft - alles so geändert, dass ich es wieder tragen mag. Ich glaube, so kann man auch mit alten Texten umgehen. Man kann sie ändern, damit sie wieder passen.
Bei www.monatslied.de gibt es eine wunderschön vertonte Version dieses Vater Unsers. Wir singen es oft in der Wohnzimmerkirche.
Restwärme

Der Engel hat sich auf Wollsocken genähert, erst in letzter Sekunde habe ich sein Kommen bemerkt. „Jedes Baby bringt eine Portion Geborgenheit auf die Welt“, sagt er. „Das ist eure Rettung. Damit ihr nicht abstumpft. Damit ihr nicht vergesst, wie das ist: Hilflos zu sein und trotzdem Willkommen. Selbst wenn die Umstände Mist sind.“ Ich zucke zusammen, seit wann klingt die Botschaft der Engel so derb? „Ist doch wahr“, sagt er. „Schau dir die Welt an. Ein Stall ist eine Wellnessoase dagegen. Ihr müsst dringend ausmisten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden!“ ruft er und verschwindet. Vielleicht ist das ein Zeichen, denke ich. Dass der Engel keiner von der abgehobenen Sorte ist. Sondern weiß, wovon er spricht. Vielleicht ist dann ja auch das andere wahr: Euch ist heute ein Retter geboren. Ein Kind in Windeln. Im Dunkel zur Welt gekommen, als alle schwarz sahen. Hat ein paar Menschenseelen erwärmt und ist weitergezogen. Aber etwas bleibt. Als wäre eben noch jemand dagewesen. Restwärme fürs Herz.
Helle Tage, gesegnete Nächte, frohe Weihnachten!
Still

Am Morgen jenes fernen Tages rasierte sich Zacharias sorgfältiger als sonst. An jenem Morgen zog er sein bestes Hemd an, das mit den Perlmuttknöpfen. Das hatte er lang nicht mehr gemacht.
Elisabeth sah ihn an und dachte, dass er alt geworden war. Ein alter Mann mit zwei Falten um den Mund und tiefer Melancholie im Blick. Ach du, dachte sie.
Im Haus war es still. Viel zu still. Zacharias räusperte sich, er konnte die Stille nicht gut ertragen. Hier hätten seine Enkel lachen sollen. Er hatte sich immer ein volles Haus gewünscht, kommen und gehen, klein und groß, Elisabeth und er, sie beide mittendrinn. Aber es war kein Kind gekommen. Kein einziges. Elisabeth wurde älter, ihre Versuche wurden routinierter und bekamen schließlich den Beigeschmack der Verzweiflung.
Elisabeth fühlte sich wund an, wundgehofft, und er fühlte sich schuldig. Und auch betrogen um ein Leben, das sie verdient hätten. Sie hörten auf, darüber zu reden. Und irgendwann hörte Zacharias auch auf, dafür zu beten. Denn auch Gott blieb stumm.
Zacharias war Priester, einer von Tausenden, aber immerhin nicht in einem verlorenen Dorf am Ende der Welt, sondern im Tempel. Im Zentrum. Da, wo immer etwas los war. Einer, der anderen Hoffnung machte, ohne selber noch Hoffnung zu haben. Aber er war gut darin. Er war wirklich gut.
An jenem Tag also war er an der Reihe, das Rauchopfer bringen. Deshalb das Hemd. Zacharias küsste Elisabeth flüchtig auf die Wange. „Bis später, Schatz.“
Im Tempel war es bereits voll. Pilgerinnen, Touristengruppen, Gläubige, Krimskramsverkäufer. Zacharias entdeckte ein paar bekannte Gesichter und setzte sein Priestergesicht auf. Warm und verbindlich. Er prüfte, ob die Kohlen glühten, der Weihrauch lag bereit. Die Zeremonie begann. Es wurde still. Zacharias sprach die Heiligen Worte, er kannte sie in und auswendig. Kurz schweifte er ab und dachte, dass er versprochen hatte, später Lammbraten zu besorgen, aber er holte sich zurück und versuchte, mehr Bewegtheit in seine Stimme zu legen. Dann ging er hinein ins Allerheiligste, dorthin durfte ihm niemand folgen. Hier war er allein mit Gott. Was für eine Vorstellung, dachte er. Und dann dachte er kurz, was er Gott sagen würde, wenn Gott wirklich hier wäre. Aber der Raum war leer, bis auf das Gold, das trotzdem glänzte. Stop, ermahnte Zacharias sich. Dies ist nicht der Ort für Zweifel.
Er nahm die Schale mit dem Weihrauch und sah den Engel. Unzweifelhaft stand er da, direkt neben dem Altar. Zacharias wollte etwas sagen, aber was?
„Hab keine Angst“, hörte er. „Euer Wunsch wird sich erfüllen. Elisabeth wird schwanger und ihr bekommt ein Kind und ihr werdet überglücklich sein.“
In Zacharias Kopf stürzte etwas ein. Jetzt hätte er jubeln müssen, hier war das Wunder, das er so lang herbeigesehnt hatte. Aber das einzige, was er dachte, war: Warum? Warum jetzt? All die Jahre, in denen wir so gehofft haben. In denen wir alles versuchten. In denen wir das Glück der anderen gesehen haben, all die vielen bitteren Jahre. Der mühsame Weg, abzuschließen. Und jetzt wieder anfangen? Von neuem anfangen zu hoffen? Zacharias spürte nichts.
„Wie kann ich mir sicher sein“, fragte er. „Wie kann ich wissen, dass es dieses Mal klappt, dass wir nicht wieder enttäuscht werden. Und wie soll das gehen? Es ist zu spät. Wir sind alt. Da wächst nichts mehr. Ich kann das auch nicht mehr, ich…“
„Still“, sagte der Engel und brachte Zacharias mit einer sanften Geste zum Schweigen. „Es liegt nicht an dir. Rede dir nichts ein. Das Leben wird wachsen.“ „Aber“, wollte Zacharias einwenden, tausend Abers lagen auf seiner Zunge. Aber sie kamen nicht raus. Kein einziges Aber kam über seine Lippen.
Draußen vor dem Tempel wunderten sie sich, wo Zacharias blieb. Als er schließlich herauskam, geschah etwas Merkwürdiges. Der Segen blieb ungesprochen. Als hätte es ihm die Sprache verschlagen. Zacharias schwieg und ging.
Er zog in einen Raum aus Stille. Neun Monate lang wohnte er darin. Neun lange Monate sprach er kein einziges Wort. Seine Stimme fing damit an. Sein Herz wurde ruhig. Die Zweifel verstummten. Irgendwann beruhigte sich auch der Zorn und sein wundgeglaubtes Herz erholte sich.
erzählt in der Wohnzimmerkirche
Superkraft

Am 21. November steht Kim an Omas Bett und denkt: „Das ist so typisch für Oma, dass sie kurz vorm Advent beschließt zu sterben.“ „Da seh ich schon die Lichter im Himmel“, lacht Oma, weil draußen jemand Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt hat. Trotz Energiesparen. Ein bisschen Licht muss sein, das findet auch Kim und strafft die Schultern. Jetzt bloß stark sein. „Ach stark“, sagt Oma, „immer diese olle Stärke. Wem willst du was beweisen? Guck mich an: Ich schaffe es nicht mal mehr, meine Kaffeetasse zu heben. Willst du etwa, dass ich so tue, als sei ich morgen wieder topfit? “ Kim schaut auf Omas dünne Handgelenke und die gläserne Haut und denkt: „Nee. Das wäre ja noch schwerer auszuhalten.“ „Siehste“, sagt Oma, weil ihre Superkraft schon immer Gedankenlesen war. „Kind“, sagt sie, obwohl Kim natürlich längst kein Kind mehr ist. „Ich sag dir eins: Wenn du glücklich sein willst, tu nicht immer so, als sei alles in Butter. Stärke ist eine Illusion. Such dir eine andere Superkraft.“ Dann lächelt sie ihr Omalächeln. „So, und nun sing mir was vor.“ Kim kann nichts singen außer „Alle Jahre wieder“. Das mussten sie in der vierten Klasse mal auswendig lernen. Bei „Geht auf allen Wegen // Mit uns ein und aus“ stirbt Oma, aber Kim singt tapfer weiter.
Samstag vorm ersten Advent wird Oma begraben. Im Ganzen, so hat sie das gewollt. Ein letztes Mal das Ausgehkleid tragen, mit Silberbrosche und dem geerbten Fuchsschwanz. „Wird ja auch wirklich Zeit, dass der endlich unter die Erde kommt“, hatte Oma gelacht. Vielleicht ist Humor auch eine Superkraft, denkt Kim und wirft einen Schokonikolaus ins offene Grab. Vollmilch natürlich. Bitteres gibt es ohnehin schon genug. Dann gehen alle zum Kaffeetrinken....
Die ganze Geschichte lesen:
Kann man auch hören: Deutschlandfunk, zum 1. Advent: hier zum Nachhören
Heilmittel

Thomas von Aquin, 13. Jh., handschriftlicher Zusatz (Echtheit noch unbestätigt)
Frühstücksei

Ich mag nur das Gelbe vom Ei. Am liebsten in diesem perfekt cremigen Zustand, nicht zu flüssig, aber auch nicht bröselig. Wenn ich ein Frühstücksei essen möchte, brauche ich also einen Mitesser. Oder eine Mitesserin, also eine Person, die lieber das Weiße mag. Das ist mir zwar unerklärlich, aber es gibt solche Menschen. Einmal traf ich einen kleinen Jungen, der war so einer. Wir wären ein perfektes Team gewesen, aber der Vater verbot es ihm. Er hatte seine Grundsätze: Der Junge müsse lernen, dass man sich nicht nur die Rosinen herauspicken dürfe.
Rosinenbrot schmeckt sehr gut mit Ei. Manche legen noch eine Scheibe Schinken darunter. Das würde ich nicht, aber sollen sie. Für mich reicht Butter. Vielleicht noch etwas Orangenmarmelade, Sanddorngelee ist auch fein. Was ich sagen will, ist: Es gibt sehr viele Möglichkeiten zu genießen. Man braucht keinen Glaubens-krieg daraus zu machen. Die Welt ist voller Köstlichkeiten, wir können sie einfach teilen. Frieden fängt beim Frühstücksei an.
Ministerin für transzendentale Sicherheit

Sehr geehrte Damen und Herren, du lieber Himmel,
wir müssen jetzt ganz stark sein: Sicherheit gibt es nicht. Das Konzept Welt ist in ständigem Wandel und niemand garantiert, dass das Spaß macht. Nicht mal, dass es instagrammabel ist. Soweit die schlechte Nachricht, jetzt die gute: Wir sind nicht allein. Verzeiht, wenn das wie Hohn klingt angesichts von Klimawandel-Leugnerinnen, Rechtsnationalen und größenwahnsinnigen Autokraten. Wir können uns darüber die Haare raufen oder ein Fort aus Decken bauen, wir können uns in unsere Höhlen verkriechen, netflixen oder – atmen.
Der Gedanke, dass acht Milliarden Menschen einmal am Tag nichts anderes tun als Atmen, wäre ein beruhigender Gedanke. Und Ruhe ist ein anderes Wort für Sicherheit. Damit meine ich nicht diese bedrohliche Ruhe vor dem Sturm, nicht die lähmende Ruhe, keine Kaninchen-vor-der-Schlange Ruhe und auch nicht diese Art von Ruhe, wenn in der SBahn alle auf ihr Handy starren. Ich denke an Ruhe, die verbindet: Hallo Gott. Ich bin hier. Du bist hier. Das reicht. Ich bin hier. Du bist hier. Das reicht. Auch wenn ich keinen Plan habe. Wenn ich mich im Gestrüpp eines zu vollen Alltags verliere. Wenn eine Flut von Scheißnachrichten runterzieht. Halten wir stand, ohne Held*innen zu sein. Eine halbe Stunde am Tag: Ich bin hier. Du bist hier. Das reicht. Listen and repeat.
Dreamer

Matze ist ein Klischee. Sein Schädel ist kahlgeschoren, sein Körper volltätowiert. Am Türrahmen hat er eine Strichliste für alle Nasen begonnen, die er schon gebrochen hat, aber irgendwann hat er den Überblick verloren. Bier ist sein Müsli. Nach einer kurzen, frühkindlichen Findungsphase hat er sich auf Hass spezialisiert.
Am 29. März spürt er, dass etwas mit ihm geschieht. Und allein das will schon was heißen. Spüren ist nicht Matzes Spezialgebiet. Irgendwas drängt ihn, an Katzenbabies zu denken, und erstaunlicherweise sind es keine Gedanken, die ertränken, erschlagen, anzünden beinhalten. Matze schüttelt sich. Schlägt mit der Pranke ein paar Mal ordentlich gegen seinen Schädel. Aber es geht nicht weg. Als nächstes ertappt er sich dabei, „Imagine“ zu summen. Er wusste nicht mal, dass das Lied in seinem passiven Erinnerungsschatz liegt. „Hä?“, grunzt Matze. „Was’n das für’n Geschwurbel?“ Die Melodie läuft unbeirrt weiter in seinem Kopf. Am Nachmittag schlichtet er Streit, kauft für Tanja ein Bund Margeriten, und als die Verkäuferin fragt, ob er einen Herzanhänger dazu möchte, nickt er beseelt. „Alter“, keucht er. „Ich muss krank sein!“ Zur Probe reißt er ein paar Autospiegel ab. Nichts. Kein Gefühl. Keine Befriedigung, im Gegenteil: Es drängt ihn, ein Entschuldigungsschreiben aufzusetzen. Einer tattrigen Oma hilft er über die Straße, und als sie die vielen bunten Bilder auf seiner Haut bewundert, sagt er artig „danke“. Den Rest gibt ihm eine humpelnde Taube, der er das Bein bandagiert. Matze K. kapituliert. Zum ersten Mal in seinem Leben. „You may say, I’m a Dreamer. But I’m not the only one…“
Opfer und Bauklötze und Wut

Es gibt
Leute, die explodieren regelmäßig. Wegen eines verspäteten Anschlusszugs oder der Sonntagsfahrer auf der Autobahn. Weil jemand keine Maske trägt, weil die Lasagne im Bistro auf sich warten lässt.
Weil die anderen anders leben wollen und keine Ahnung haben. Zugbegleiter werden angeschrien, Polizistinnen, Mitarbeiter in sozialen Einrichtungen, Politikerinnen. Vom Internet erst gar nicht zu
reden. „Das musste mal raus“, scheint ein ausreichender Grund zu sein. Aber eine Gesellschaft ist kein Kindergarten. Da kann nicht einfach jeder losschreien, wenn ihm was nicht passt. Und selbst
im Kindergarten lernt man: du sollst deinen Nächsten nicht mit Bauklötzen bewerfen.
Was das mit Kain und Abel zu tun hat und warum ich nicht glaube, dass Gott Opfer braucht: Deutschlandradio Kultur
Wer bist du?

Ich bin seit 49 Jahren Mensch. Im Körper einer Frau. Manchmal fällt mir das auf, aber eigentlich ist es so selbstverständlich, wie eine Nase zu haben. Ich kann gut zuhören, aber nicht nähen. Ich mache gern Feuer, finde Röcke angenehmer als Hosen und mochte rosa schon, bevor es Prinzessin Lillifee trug. Ich habe keine Kinder geboren und bin glücklich damit. Ich fahre gern Auto, genieße es manchmal, mich anzulehnen und übernehme an anderen Tagen die Führung. Ich hasse es, mein Fahrrad zu flicken und freue mich, wenn jemand Spinnen aus dem Weg räumt. Eine Maus würde ich aber jederzeit auf die Hand nehmen. Manchmal bin ich härter als ich will. Ich koche täglich, eine Bratpfanne auf dem Geburtstagstisch wäre für mich keine Beleidigung. Fußballübertragungen langweilen mich, Fashionfragen auch. Ich habe eine Vulva und finde das gut, allerdings habe ich auch keinen Vergleich, wie es mit einem Penis wäre (etwas unpraktischer stelle ich es mir vor). Die Frage, ob ich mich weiblich fühle, spielt für meine Identität keine große Rolle. Ich bin ich. Ich fühle mich gut (jedenfalls im Großen und Ganzen). Und ich möchte in einer Welt leben, in der das jede und jeder von sich sagen kann. In der Menschen dieselben Rechte haben. Einen Rock tragen dürfen und einen Bart. An manchen Tagen zartbesaitet sind, an anderen gestählt. Alle Zeit der Welt mit Kindern verbringen dürfen, ohne sich zu erklären; mit einem Floß den Mississippi queren oder glücklich hinter Aktenordnern verschwinden. Mit Hüftschwung durch die Straßen gehen oder mit Stiernacken. Und das alles sollte keine Frage des Geschlechts sein, sondern der Sehnsucht: Wer bist du? Was entspricht dir? Ich möchte in einer Welt leben, in der es weniger Kategorien gibt und mehr Sein.
Geröll und Topfenstrudel

Ich bin auf einen Berg gestiegen, habe den Kühen gesagt, sie mögen auf ihrer Seite bleiben, bin über 100000 Kilo Geröll geschlittert, und am Ende bin ich in den See gesprungen und habe einen Saibling getroffen.
Die Freiheit war auch unterwegs, sie lief immer einen Schritt voraus. Manchmal saßen wir zusammen auf eine Stein. Ihre Nachbarin ist das Glück und eine Gams, beide sind etwas scheu.
Ich habe ein Käsebrötchen gegessen und keinen Topfenstudel. Obwohl er sich angeboten hat, aber das war mir zu aufdringlich. Die weiteren Aussichten sind unbestimmt. Das Handy sagt, ich solle es in den See werfen. Das sei auch Freiheit.
#schreibreise #kalkalpen
Pfingstbeflügelung

Ich glaube an Vorfreude
auf Honigbrot und Höhenflüge
weil im Moment davor alles möglich ist.
Ich glaube an Vergebung
Ich glaube, dass auch im Moment danach
Nichts unmöglich ist.
Ich glaube, dass Gott eine Zauberin ist.
Ich glaube an Schmetterlinge
Ich glaube an alle
die gerade Raupen sind
Halber Himmel

Morgens stehe ich aus dem Bett auf. Mittags vom Tisch. Aber vom Tod? Keine Ahnung. Ich glaube es versuchsweise, und wenn es dann nicht klappt, wenn dann alles schwarz und Schlaf ist, dann merke ich es ja nicht mehr. Bis dahin lebe ich. Esse Zimt-schnecken, halte meine Nase in die Sonne, stell mich in den Kirschblütenregen, streite (aber schmolle nicht) und feiere das Leben, so oft ich kann. Muss alles immer erfüllt sein? Ist es sowieso nicht, jedenfalls nicht in meinem Leben. Mir reicht ein halber Apfelkuchen, ich brauche keinen ganzen. Wer immer auf Erfüllung wartet, könnte am Ende mit leeren Händen dastehen. Ich möchte mich erinnern an ein paar spontane Ausflüge ans Meer, an das Lachen meiner kleinen Nachbarin, an Bring-was-du-hast-Abende, an Küsse im Nieselregen, an das ein oder andere gelesene Buch, an den Geruch von Waldmeister im Mai. Ich möchte mich daran erinnern, dass ich schon jetzt mehr Erinnerungen habe, als ich mir träumen ließe. Rette mich, Gott, vor der Vorstellung, dass immer noch was Größeres kommen muss. Der Himmel beginnt hier, mit einem halben Fuß steh ich schon drin.
Weniger ist Meer

Vielen Dank
für 20 rechte Hände
und das Rascheln der Bleistifte auf dem Papier
Vielen Dank für die Möwe,
die mein Eis verschont hat
Vielen Dank für das Glück,
frei zu sein und einfach auf eine Insel fahren zu können
Vielen Dank für Sanddorngelee
einen Platz im Strandkorb
und einen Morgen aus Gold
Vielen Dank für Dinge
die schon immer mal gesagt werden wollten - Brathering, Himmelsexpeditionen und die Geschichte eines Föns
Vielen Dank für das Meer
nicht weniger als das.
Eine Woche Schreibworkshop auf Langeoog.
Tschüss, bis nächstes Jahr!
Ich wünschte

Statusmeldung
Im Fernsehen weint ein Mann.
Er hat dieselben Leichen gesehen wie ich - aber in echt.
Ich schalte den Fernseher aus und koche Griesbrei.
Mit Omas Messer schneide ich einen Apfel.
Ich weine, dass die Welt nicht klüger wird.
Ich weine vor Entsetzen und rieche Vanille.
Von hier

Was ich von hier aus sehe
Rosa Blüten, die sich nicht einschüchtern lassen.
Sanftmut ist auch eine Stärke.
Ich trainiere täglich eine halbe Stunde:
Widersprechen in Fis-Dur.
Mit einem Rhinozeros auf Zehenspitzen tanzen.
Einen Streit als Stummfilm führen.
Zuversicht verstreuen. Mich besonnen.
Offener Brief an Gott

Wenn es dich gibt, warum greifst du nicht ein? Nein - halt, warte, das soll gar keine Frage sein, weil jetzt nicht die Zeit für philosophische Gedankenspiele ist. Wenn es dich gibt, dann tu was. Fall Herrn Putin in den Arm und seinen Mitstreitern auch. Du kannst einwenden, dass meine Bitte spät kommt, Kriege gibt es auf der Welt, solange ich lebe. Du hast recht. Aber ich bin - im Gegensatz zu dir - ein Mensch. Je näher das Unfassbare kommt, desto fassungsloser macht es mich. Ich habe kluge Bücher gelesen und mir Antworten zurechtgelegt, warum du das tust: Nichts tun. Dass du nicht kannst, ist so ein verstörender Gedanke. wenn nicht mal du - wie dann wir? Ich wage nicht, um Trost zu bitten, weil andere den viel dringender brauchen. Jede Bitte kommt mir falsch vor, weil hinter allen Bitten die eigentliche steht: Mach dem Töten ein Ende.
Ich fühle, dass es dich gibt. Ist das alles?, frage
Ich (gerade auf Flügeln der Morgenröte unterwegs)
Ungeduld

Als erstes wird der Frühling kommen. Und er kommt, soviel ist immerhin sicher. Und es wird Tage wie diesen geben, an denen die Sonne scheint, und der Himmel ist klar, und ich werde mich hinausträumen in den Wald, der hellgrün trägt und süß riecht. Und für einen Moment wird mich das beruhigen. Und dann wird mir das Lied von den Mandelzweigen in den Sinn kommen, das ich mich eigentlich schäme zu singen, weil es so eine naive Gott-macht-alles-gut-Haltung dahinträllert, aber plötzlich ist es erwachsen geworden und beharrt darauf, dass Waffen schweigen werden, die Lieder aber nicht. Und dass im Übrigen nicht ich Richterin zu sein brauche, der Job ist zu groß für mich, schon gar nicht Weltenrichterin. Die Stelle sei auch schon vergeben, sie säße wachsam auf ihrem Platz, ihre Engel leisteten Erste Hilfe, manchmal gelänge es ihnen auch einzugreifen, aber was solle man schon tun gegen abertausend Soldaten. Wo ist das Licht, frage ich, wenn Menschen sterben? Wie soll man da überhaupt ein Lied singen, wie soll man da glauben an die Vernunft, an die Liebe, an eine Zukunft, die gemeinsam stattfindet? Die Weltenrichterin wird weise ihre Antwort wägen, sie rechne in Jahrtausenden - und entschuldigt sich dafür, sie wisse, sie verstehe mittlerweile, was Ungeduld heiße, deshalb schicke sie Sonnentage und Frühling und Lieder und Engel, und alles, was sie habe.
Ohne Titel

’s ist Krieg! ’s ist Krieg! O Gottes Engel wehre,
Und rede Du darein!
’s ist leider Krieg – und ich begehre,
Nicht schuld daran zu sein!
Matthias Claudius, 1778
Ich will mich verkriechen. Russland hat die Ukraine angegriffen. Es ist Krieg. Dagegen wirkt Corona blass. Ich muss mich zwingen zu arbeiten (weil mir nichts besseres einfällt). Wann wird es wieder gut sein? Wann wird man rausgehen können und die wichtigste Nachricht des Tages ist eine neue Bucherscheinung oder die Ankunft der Zugvögel?
Gestern saß ich in der Kirche und sah, wie ein Sonnenstrahl den Flügel eines Engels streifte, während in den Nachrichten Bomben fielen. Der Engel hielt einen Siegeskranz in den Händen, Frieden ruft er, und ich halte mich fest an der Hoffnung, dieser Engel sei längst unterwegs.
Staub und grüner Klee

Glaubst du an Gott? Und wenn ja: Glauben du, dass Gott etwas Bestimmtes mit dir vorhat? Dass da ein eingespeicherter Plan ist, der deinem Dasein einen Sinn gibt?
Ich glaube an Gott. An einen Plan glaube ich nicht. Obwohl mir der Gedanke gefallen würde: Mit einer Mission unterwegs zu sein. Bei der jede vertrödelte halbe Stunde an der Bushaltestelle, jede schlaflose Nacht einen Sinn bekäme. Eine Mission, die bestimmte Fragen ein für alle Mal klärt: Wofür ich aufstehen soll. Ob Abwasch oder Twitter gerade wichtiger ist. Welche Freizeitbeschäftigung mich erfüllt. Eine Mission, der ich zielgerichtet durch den Alltag folge. Eine Mission, die aus mir eine Superheldin macht.
Aber Gott schüttelt den Kopf: „Nope. Keine Mission für dich. Die schlechte Nachricht ist: Ich brauche dich nicht.“ Das muss erstmal sacken. In der Sache überrascht mich das nicht wirklich, aber etwas mehr Behutsamkeit hätte ich von Gott schon erwartet. Zwar bilde ich mir nicht ein, unersetzlich zu sein. Schon gar nicht weltweit betrachtet. Aber es wäre schön zu wissen: Susanne, die ist dafür da, dass 17,3 % ihres Umfeldes weniger streiten. Noch besser wäre natürlich etwas Größeres. Susanne soll eine Pyramide bauen. Zum Beispiel. Etwas Konkretes, an dem man arbeiten kann im Leben. Zeichnungen anfertigen, Räume ausmessen, Steine hauen, Mittagspause machen und ein Käsebrot essen. Start and Repeat. „Die Welt braucht keine Pyramiden mehr“, holt mich Gott zurück. Ich frage: „Was dann?“
Gott räuspert sich: „Ich zitiere: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was ich von dir will: Gerechtigkeit tun, Freundlichkeit lieben, und demütig mitgehen mit deinem Gott. Die Bibel, Buch Micha, Kapitel 6.“
Ich zucke zusammen. Demut. Wirklich? Das verstaubteste aller Mutworte?
Was die gute Nachricht ist und warum Demut ein Mutwort ist, das nur auf den ersten Blick schüchtern wirkt, erzähle ich hier:
Weiterlesen oder hören: Deutschlandfunk Kultur
Neulich auf dem Weg zum Bahnhof

Jesus treibt sich auch wieder in den schummrigsten Ecken rum...
Lichtmess

Der Morgen leuchtet heller als der letzte Stern in meinem Fenster.
Zwischen Inzidenzen wachsen Krokusse. In die Nachrichten mischt sich das Lied einer Amsel. Ich packe mein Weihnachts-Ich in Holzwolle, falte die Decke zusammen und verlasse die Enge des Stalls. Irgendwas kommt mir entgegen. Ich weiß noch nicht was, aber es wird sich lichten. Täglich 3,41 Minuten mehr.
Frohe Weihnachten!

Dass Weihnachten ein Fest für Naive sei, lese ich, weil niemand die Welt retten kann. Schon gar nicht ein Kind, auch in 2000 Jahren nicht. Dann will ich naiv sein. Wenigstens einmal im Jahr will ich meiner Kinderseele recht geben, die darauf besteht, dass Herbergen sich öffnen. Die glaubt, dass es solche Nächte gibt, in denen Rosen blühen und das Eis schmilzt. Wenigstens einmal im Jahr sollen die Herzen weich werden und durchlässig, damit wir nicht verlernen, wie das geht. Soll die Sehnsucht Raum finden, damit wir nicht verrohen. Mag sein, dass das die Welt nicht ändert. Aber uns.
Lieber Sonntag,

jede Woche freue ich mich auf deinen Besuch. Du bringst Brötchen mit oder Kuchen, und immer nimmst du dir einen ganzen Tag Zeit. Früher konnte ich nicht so viel mit dir anfangen. Da hielt ich dich für etwas verschroben. Jetzt mag ich das. Dass du so anders bist. Mit dir kann man Pläne schmieden, auf dem Sofa lümmeln, in dicken Büchern versinken, die Zukunft rosa färben, eine geheime Sprache erfinden, mit dir kann man den Himmel stürmen. Du bist zwecklos, und das entspannt mich. Du willst nichts von mir. Du stellst Fragen, für die ich sonst nie Zeit habe: Wofür ich lebe. Was mich glücklich macht. Was ich der Welt geben will. Ob Himbeeren was mit Himmel zu tun haben. Ich mag auch deine Fürsorge. Du hast ein Auge auf mich. Siehst, wenn ich müde bin, und dann machen wir einen Mittagsschlaf. Wenn ich Wind um die Nase brauche, ziehst du mich raus. Manchmal redest du mir ins Gewissen: "Mach mal was, das du nicht musst. Heute gehörst du mir - und ich gebe dir frei." Das ist deine Art der Liebeserklärung. Du bist ein Schatz!
Unser Kalender für 52 unverbrauchte Sonntage ist fertig: Luft nach oben 2022! Den Kalender könnt Ihr hier bestellen.
Advent

An einem Herbstmorgen
hol die rote Mütze raus
nimm die Einsamkeit von der Stirn
schreib einen Brief auf Zeitungspapier
bau deinen Himmel aus Atemwolken
der Engel ist Zigaretten holen
warte nicht
Nocheinmal!

Für alle halb gelebten Leben
und für alle himmelhohen Träume.
Für alle missglückten Anfänge
und für das Glück, das noch aussteht.
Für alle Liebe, die auf der Strecke blieb
und trotzdem nicht verloren ist.
Für alle kühnen Versprechen und auch für die Halbherzigkeit.
Für alles Scheitern, für alles Nocheinmal.
Für das, was offen ist.
Für die angebrannten Kekse und das halbvolle Glas.
Für das Hoffen und das Sehnen.
Für viel zu große Schuhe und klitzekleine Schritte.
Für die Lust, für die Leichtigkeit.
Für uns, Held*innen und Hasenfüße.
Wohnzimmerkirche

Warum ich Wohnzimmerkirche so mag:
weil der Raum offen ist und das Licht weich. Vieles ist in der Schwebe. Vielleicht auch Gott. Niemand hat den Gral. Oder alle. Weil Jan so wunderschön unspektakulär singt. Ohne Wehr und Waffen. Weil Gedanken im Reden entstehen. Miteinander reden. Liebe schmeckt nach Cider und macht nicht viel Aufheben. Ist einfach da. Und weil manchmal schon eine bunte Lichterkette und ein paar Gleichgesinnte genug sind.
Andererseits

Einerseits ist nun leider November. Andererseits leuchten die Ahornbäume nie schöner als jetzt. Auf meiner Liste rangeln die To-dos um den ersten Platz. Andererseits ist morgen sowieso Wochenende. Meine Friseurin sagt, keiner hat mehr Lust auf Corona. Ich auch nicht. Also muss ich lernen, für meinen Lockdown selbst zu sorgen, wenn alles zu eng wird. Ein Freund ist begraben. Die Motten im Keller lassen sich nicht unterkriegen. Ich wünschte, es wäre andersherum. Das Leben richtet sich nicht nach meinem Wunschzettel, jedenfalls nicht zuverlässig. Ich schreibe trotzdem einen, mindestens in Gedanken. Wünsche halten das Herz warm. Drinnen riecht es nach Heizungsluft, andererseits habe ich endlich wieder eine Heizung und keinen Nachtspeicher mehr. Letzte Woche hat sich im Traum der Himmel geöffnet. Wunschdenken sagen die einen. Trotzdem bleibt ein Leuchten zurück.
Drinnen

Vergesst nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt.
Die Bibel, 1. Korinther 6, 19-20
Auf der Suche nach Gott tritt sie in die Kirche. Die Tür ist offen. Drinnen brennen Kerzen und es riecht nach Nelken, die jemand auf den Altar gestellt hat. Sie setzt sich. Lange war sie nicht mehr hier. Doch schon bald tut ihr auf der harten Bank der Rücken weh. „Das musst du aushalten“, ermahnt sie sich, aber vor lauter Aushalten vergisst sie, wonach sie sucht, und nach einer halben Stunde geht sie unverrichteter Dinge nach Hause.
Gott hat sie sich immer erhaben vorgestellt. Einer, der in einem Haus wohnte, dessen Säulen in den Himmel ragen, muss einfach erhaben sein. Gold ist sein Kleid. Ihre Kleider dagegen hängen wie Säcke an ihrem unförmigen Körper. Das hat ihre Mutter mal gesagt, und sie hat es nie vergessen. Obwohl es schon Jahrzehnte zurückliegt. Heute sieht sie auf Instagram Pastellfotos lichtgefluteter Frauen, deren feingliedrige Hände einen Becher Kräutertee mit dem schönen Namen „Seelenzauber“ umfassen. Manchmal lächeln sie auch aus einer komplizierten Yoga-Pose entspannt in die Kamera. Dazu posten sie das Hashtag #Selbstliebe, als sei es das Normalste von der Welt. Ihr ist das fremd. Sie würde wetten, dass ihre Mutter das Wort nicht mal kennt. „Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach…“, murmelte sie Woche für Woche. Die Hände gefaltet, den Kopf gesenkt. Selbstliebe klingt verdächtig nach Eitelkeit, denkt sie. Eine der Hauptsünden, hat sie gelernt. Die von Gott ablenken.
In dieser Nacht träumt sie, dass sie mit Gott verstecken spielt. Auf einmal ist sie wieder Kind in ihrem rotgepunkteten Lieblingsrock. „Mäuschen, sag mal Piep!“, ruft sie, und Gott ruft „Piep!“ Aber sie kann Gott nirgends finden, nicht hinterm Sofa, nicht unterm Bett, nicht im Schrank. „Näher“, flüstert Gott, „viel näher“, und die Stimme scheint eindeutig aus ihrem Bauch zu kommen.
Was man für einen Unsinn zusammenträumt, denkt sie beim Aufwachen. Trotzdem cremt sie sich an diesem Morgen besonders sorgfältig ein. Sie lässt keinen Zentimeter und keine Delle ihres Körpers aus, der plötzlich so viel mehr sein könnte, als eine unvollkommene Hülle für Herz, Niere, Lunge und ein paar Meter Blutgefäße.
Sternchen

Das ZDF gendert Islamist*innen. Viele finden das blöd. Ich finde es gut. Solange man kein Dogma daraus macht. Nicht bei jedem vergessenen „innen“ eine Grundsatzdiskussion beginnt, nicht wegen eines kleinen Sternchen den Weltuntergang wittert. Meine Aufgabe ist es, kreativ damit umzugehen. Eine Sprache zu finden, die schön und präzise ist und den Horizont weitet. Das ist manchmal tricky, aber das ist es auch ohne Gendersternchen. Ich sehe es als Herausforderung. Und ich mag Herausforderungen. Als ich „Islamist*innen“ las, habe ich mich natürlich sofort gefragt, wieviel weibliche es wohl gibt. Und wie viele, die sich keinem Geschlecht oder beiden zuordnen. Letztere tendieren wahrscheinlich gegen Null. Zumindest jene, die sich das eingestehen. Dabei könnte es sie trotzdem geben. Das Sternchen macht die Welt und mein Denken mehrdimensionaler.
Ich schreibe selten über Islamist*innen und mehr über Gott. Dass Gott kein Er ist und keine Sie, ist sowieso klar. Trotzdem wird oft so gesprochen, als sei Gott ein mittelalter Mann mit Hut. Wieso reden wir immer noch so? Herr, Vater, Schöpfer, Er. Ich weiß: Grammatikalisch ist das eine Herausforderung, weil Gott im Deutschen genauso männlich ist wie der Baum und der Apfel. Ich habe mein halbes christliches Leben damit verbracht, zu übersetzen. Mitgemeint zu sein, wenn von Brüdern die Rede ist oder von Christen. Neben die Metapher des Vaters die Mutter gesetzt (und immer gedacht: Ziemlich doof, wenn jemand mit einem oder beiden Elternteilen nichts Gutes verbindet. Was ja nicht so selten ist.). Meine Vorstellung von Gott ist integrativ. Jeden und jede zu sehen, weiter, offener, liebender als ich das kann.
Schäm dich. Nicht.

Als Adam und Eva einander kennenlernten, war alles unkompliziert. Hatte Adam einen Bauchansatz? Waren Evas Beine rasiert, lag ihr Bodymassindex im grünen Bereich? War Adam ein echter Mann, war Eva eine richtige Frau? Wir wissen es nicht. Alles, was berichtet wird, ist: Sie waren nackt und schämten sich nicht. Offenbar gab es nichts zu verheimlichen und nichts zu retuschieren. Sie waren, wie sie waren, und das war gut.
Anfang zwanzig wurde ich zum ersten Mal mit den Haaren auf meinem Körper konfrontiert und der Ansage, dass sie da nichts zu suchen haben. Bislang hatte ich sie zur Kenntnis genommen wie meine Ohrläppchen und meinen linken kleinen Zeh. Sie waren eben da, benötigten aber keine besondere Aufmerksamkeit. Auf einmal wurden sie peinlich. Ich lernte, mich zu rasieren und mich zu schämen, wenn ich es vergaß. Heute gibt es in sozialen Netzwerken ernsthafte Diskussionen darüber, wie schlimm es ist, wenn Frau (zuweilen auch Mann) Körperhaar zeigt. Und nicht nur darüber – auch über die Lücke zwischen den Oberschenkeln und die Optik der Schamlippen kursieren Schönheitsvorgaben. Bodyshaming nennt man die Ansage, wenn nicht alles passt.
Scham ist ein fieses Gefühl. Es suggeriert: Du bist nicht richtig. Du gehörst nicht dazu. Wie kannst du es wagen, dich so zu zeigen? Körperbehaarung ist da noch ein vergleichsweise kleines Problem. Man kann sich schämen, arm zu sein, die Verhaltenscodes für eine bestimmte Gruppe nicht zu kennen, keine Kinder oder zu viele Kinder zu haben, den falschen Beruf auszuüben und „nur“ Putzkraft zu sein. Menschen schämen sich, gemobbt oder missbraucht worden zu sein. Man kann sich schämen, da zu sein...
Scham ist ein ambivalentes Gefühl. Zu viel davon tut nicht gut – es macht uns kleiner, als wir sind. Zu wenig davon tut auch nicht gut – es macht uns größer, als wir sind. Scham ist die innere Stimme, die sagt: Du bist nicht Gott. Brauchst du auch nicht zu sein.
(...)
„Der liebe Gott sieht alles“, habe ich irgendwann gehört. In einem Kinderlied aus den 1970ern heißt es: „Pass auf, kleines Auge, was du siehst! Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst! Pass auf, kleine Hand, was du tust! Pass auf, kleines Herz, was du glaubst! Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich…“
Gott als großer Stalker. Als verlängerter Arm irdischer Moral: Gott sieht, wenn du auf Mama und Papa wütend bist. Wenn du Kekse aus der Dose klaust. Gott sieht, wenn du heimlich rauchst, wenn du masturbierst, wenn du davon träumst, deinen Schwarm aus der Nachbarklasse zu küssen. Gott sieht all deine Gedanken. Über allem schwebt das Damoklesschwert der Scham. Denn wie wahrscheinlich ist es, einen solchen Gott zufriedenzustellen?
Ich glaube nicht, dass Gott ein Aufpasser ist. Ich glaube auch nicht, dass Gottes Blick beschämt. Er richtet auf.
Adam und Eva haben viele Nachkommen. Sie sind Allerweltsmenschen und tragen unsere Namen. Adam ist ein Angsthase. Eva will endlich aufhören, ihre Körperhaare zu entfernen. Simon wohnt im Nachbarhaus und liebt Joschua. Werner singt im Kirchenchor und träumt manchmal von Sachen, die er keinem erzählen würde. Elisabeth träumt mit 79 immer noch von Sex – und schläft mit einem jüngeren Mann. Klaus weint, wenn er den Soldaten James Ryan sieht und wenn er im Stadion die Nationalhymne singt. Esther kocht für sieben Enkel und weigert sich, zur Sportgruppe zu gehen. Ben pflückt Blumen und spielt gern Paintball. Janne baut lieber ein Bücherregal anstatt zu bügeln. Michael träumt davon, Michaela zu heißen. Christiane ist es manchmal unangenehm, einfach nur Mutter zu sein und liebt es trotzdem. Kemal will der Stärkste sein und dennoch zärtlich. Laya wird Physikerin und kauft Kuchen eingeschweißt im Supermarkt. Oliver neigt zur Hochstapelei und besitzt gleichzeitig eine gute Portion Selbstironie. Maren liebt Tom und liebt Yasmin.
Und für nichts davon, aber auch für gar nichts davon brauchen sie sich zu schämen.
Weil ein wohlwollender, zutiefst freundlicher Blick auf ihnen ruht, der sagt: Du bist richtig. Dieser Blick gilt jedem Menschen, und wer das vergisst, kann sich erinnern, wenn das Gefühl, falsch zu sein, groß ist: Du bist sehr gut.
Ganzen Artikel lesen oder hören: Am Sonntagmorgen. Deutschlandfunk
Saumselig

Heute war ein guter Tag. Ich habe keine Wand gestrichen, auch habe ich den Kühlschrank nicht abgetaut. Ich habe kein Problem gelöst, nicht ein einziges. Aber auch keines schlimmer gemacht. Das Gras ist ungemäht geblieben. Die Zeitung liegt ungelesen auf dem Küchentisch. Ich habe mich nicht angestrengt, mein Geld habe ich nicht vermehrt (ich wüsste auch nicht, wie). Ich bin mit niemandem in Streit geraten, habe nichts besser gewusst, und auch die Zeit habe ich nicht versucht, anzuhalten.
Saumselig bin ich durch den Tag gegangen. Das ist ein Wort, das auf der Zunge zergeht. Versäumen steckt darin. Manchmal muss man was ausfallen lassen, damit das Glück einen antrifft. Meine Seele ist sehr glücklich darüber, abkömmlich zu sein. Sie ist unterwegs in anderen Sphären, ist Zitronenfaltern hinterher-geflogen und hat Himbeeren gepflückt. Gegen Mittag habe ich sie im Gras liegen sehen, ihre Träume waren blau. Abends hatte sie dann so ein Lächeln im Gesicht, als wüsste sie etwas, das ich noch
nicht weiß. Eine Ahnung von mir, wie ich bin, wenn ich nicht muss.
Kann man auch hören: NDR-Moment Mal
Zugreifen

Der Dienstag vor 2000 Jahren begann nicht gut. Der Himmel ist bewölkt. Die Brotpreise steigen. Es gibt Hassbotschaften, selbst aus unserem Netz. Wir brauchen eine Pause, das ist offensichtlich. Also brechen wir auf und verschwinden. Denn das habe ich gelernt in dieser Zeit: dass man es nicht allen recht machen kann.
Aber wir bleiben nicht allein. Andere kommen dazu. Leute, die wir noch nie gesehen haben. Wir setzen uns ins Gras. Es liegt was in der Luft: Etwas Unvollendetes, eine Sehnsucht, die sich heute Abend erfüllen könnte. Ich bin das Licht, sagt Jesus, und die Leute halten ihre Gesichter in die Sonne. Ich bin das Brot, sagt er. Ich schließe die Augen und lasse die Worte auf der Zunge zergehen.
Es ist spät, flüstert Petrus. Die Leute haben Hunger. Und dass wir jetzt mal was organisieren müssten. Ich schließe meine Augen wieder. Ich will nichts organisieren.
Am Horizont erscheint der erste Stern. Schickt sie nicht weg, sagt Jesus. Es ist so schön. Gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben fünf Brote, zwei Fische und einen angebissenen Apfel. Jesus sieht zum Himmel und dankt dafür. Ich kenne niemanden sonst, der für einen angebissenen Apfel dankt. Für das Wenige, das Halbe, das Unvorbereitete. Das, was jetzt da ist. Mein Herz klopft, als er uns das Brot gibt. Nehmt, sagt er. Gebt. Wir reichen weiter, was wir haben. Ohne abzuzählen. Ohne uns zu versichern, dass es genug ist. Wir machen einfach. Die Mutigen greifen zu. Schmecken. Kosten den Moment und genießen. Keiner beschwert sich, dass es zu wenig ist. Niemand drängelt. Alle machen mit. Die Angst, es könnte nicht reichen, verschwindet. Über die Wiese wehen Worte und Lachen, jemand holt eine Mundharmonika raus. Es ist längst dunkel geworden, aber niemand will gehen. Ist das ein Wunder?
Neustart
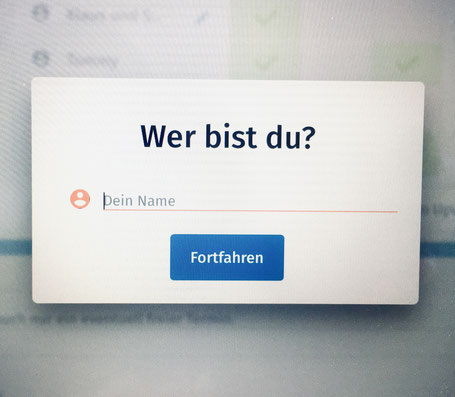
Als um 12 Uhr 17 die Welt neugestartet wird, hat Heiner mal wieder nichts mitbekommen. Dabei haben sie es auf allen Sendern gebracht: Dass man alle Anwendungen schließen solle. Was nicht gespeichert ist, ginge verloren. Vorsorgliche Menschen haben Sicherungskopien ihren Lebens gemacht, um genau dort wieder beginnen zu können, wo sie aufgehört hatten. Heiner natürlich nicht. Er hätte nicht mal gewusst, wie das geht.
Plötzlich ist alles so aufgeräumt. Nirgends hakt es mehr. Kein Update wartet. Stattdessen liegt etwas Neues in der Luft. Während die einen panisch versuchen, einen Techniker zu bekommen, der ihr altes Leben wiederherstellt, feiern die anderen, dass die Schulden gelöscht, Viren verschwunden und auch der Streit mit Isabelle aus der Welt ist. Heiner kratzt sich am Kopf, und dann öffnet er ein neues Fenster. Die Zukunft wird sich zeigen.
Pfingsten reloaded

In jenen Tagen geschah es, dass sie hinter verschlossenen Türen saßen und ihre Gesichter grau geworden waren und ihre Worte drehten sich im Kreis. Gremien wurden berufen und Ausschüsse gebildet und Antworten wurden an Fachleute delegiert und der Kleinmut hatte sich breitgemacht. Da wundert sich Gott: „Welche Fachleute denn? Die Fachleute, das seid doch ihr. Habe ich denn einige höhergestellt als andere? Habe ich meine Worte exklusiv verteilt? Ich habe sie in euren Mund gelegt und die Begeisterung in euer Herz.“ „Aber wir“, sagen sie, „wir wissen doch auch nicht. Einer glaubt so, die andere so. Wir sind so verschieden, wir können uns nicht einigen. Wir haben siebenundneunzig Punkte auf der Tagesordnung, und wenn wir fertig sind, dann fangen wir wieder von vorn an, weil niemand uns versteht!“ Da öffnet Gott die Türen und reißt die Fenster auf, dass Wind in die Sache kommt und die Angst fortpustet und Friederike fühlt sich plötzlich beschwingt wie nach einer halben Flasche Champagner. Der Herr Bischof spürt ein Beben in seinem Herzen und ist so erleichtert, weil er mit seiner Liebe nicht mehr hinterm Berg halten muss. Egon Hinterwald wundert sich, dass man alles auch ganz anders sehen kann, als er es tut, aber noch mehr wundert ihn, dass ihn das gar nicht mehr ängstigt. Hilde aus dem Frauenkreis lernt von Janne, was „queer“ bedeutet und beide spüren eine Weite im Kopf, als hätten sie nach Jahren den Dachboden entrümpelt. Worte wie Sehnsucht, Großmut, Gnade leuchten auf. Nichts davon lässt sich in Stein meißeln. Zwischen den alten Mauern wird es eng. Gott ruft: „Wer hat gesagt, dass Ihr Mauern braucht?“ Ein Hauch genügt, sie zum Einsturz zu bringen und Himmel breitet sich aus, schillernd und schön. Gemeinsam treten sie ins Freie, Friederike und der Herr Bischof, Hilde und Egon. Petrus und Phoebe sind dabei, Johanna und Jakobus. Herr Windli bringt seine Maria mit und Janne schwenkt eine Regenbogenflagge. Mireile singt ein gregorianisches Lied, nebenan setzen Technoklänge ein – und es ergänzt sich erstaunlich gut. Dazwischen schwebt Gott, überall zugleich. Alle haben sie gesehen, haben ihn gehört, haben es gespürt. Tausend Geschichten werden zu einer. Niemand will Recht haben. Macht ist ein vergessenes Wort, denn alle verstehen, was stark macht: Miteinander reden, voneinander lernen, aufeinander hören. Eine macht den anderen groß. Niemand will der Größte sein.
Und alle Welt beginnt zu staunen über jene, die leicht wirken und deren Worte nicht erschlagen, sondern prickeln wie Champagner oder weiße Johannisbeerschorle.
Als ich mit Jesus auf dem Balkon sitze

»Ich bin glücklich.«
Die Sonne ist gerade hinter den Häusern verschwunden. Du hast die Füße auf die Brüstung gelegt und balancierst auf deinem Bein ein Bitter Lemon.
»Überrascht dich das?«, fragst du.
»Ich weiß nicht. Glück ist so ein großes Wort. Muss man sich das nicht für die wirklich großen Momente aufsparen?«
Du lachst. »Hast du Angst, dass es sich abnutzt?«
Was weißt du schon vom Glück, frage ich mich stumm, um dich nicht zu verletzten. Du hörst es trotzdem.
»Du denkst, ich habe mein Glück geopfert. Für etwas Größeres. Aber so ist es nicht. Jetzt zum Beispiel möchte ich nichts lieber tun, als hier mit dir zu sitzen.«
Ich bin ein bisschen verlegen, weil ich mich freue.
»Ich kaufe Brot«, fährst du fort. »Ich helfe einem Gelähmten auf die Beine.
Wenn es einen Dämon zu vertreiben gibt, vertreibe ich ihn. Ich bete.
Ich wasche meine Füße. Ich kämpfe für so etwas Großes wie Gerechtigkeit.
Aber ich denke nicht darüber nach, ob ich lieber etwas anderes täte.
Oder woanders sein wollte.«
»Wirklich nie?«
Du schüttelst langsam den Kopf.
Deshalb also fühle ich mich so wohl bei dir.
aus: Schau hin. Vom Hellersehen und Entdecken
Nach einem Zoom-intensiven Wochenende

Gott zoomt jetzt oft. Wo er sich seltener unter die Leute mischen kann. Früher saß er freitags oft in der Kneipe neben Monika, und wenn es spät wurde, dann hakte er den Hans unter und passte auf, dass er nicht über einen Bordstein stolperte. Aber die Kneipen haben zu. Hans sitzt viel zu oft allein in seinem Zimmer. "Treffen wir uns auf Zoom", sagt Gott, aber Hans macht eine verächtliche Handbewegung. "So'n Schnickschnack mach ich nicht mit." "Bitte", sagt Gott, "wo du doch das neue Handy hast." Aber Hans will nicht. Gott lässt nicht locker.
"Weiß nicht, wie das geht", murmelt Hans schließlich.
"Musste ich auch lernen", sagt Gott, "ist nicht schwer."
Da wird Hans hellhörig. "Du? Wenn einer nix lernen muss, dann doch wohl du!"
"Hans, wie kommst du denn auf sowas." Und dann sagt Gott einen seiner Sätze: "Ich werde sein, der ich sein werde." Und weil Hans guckt, wie er guckt, wenn er mit was nichts anfangen kann, sagt Gott es nochmal in anders: "Ich höre nie auf zu Werden."
Das verschlägt Hans fast die Sprache. Weil es so anstrengend klingt: "Wieso das denn?"
"Ich werde, damit du wirst", sagt Gott.
Hans lächelt schief, er hat keine Ahnung, was Gott damit meint. Aber es klingt gut.
Berühr mich (nicht). Noli me tangere

Er ist tot. Mausetot. Auch, wenn sie es nicht wahrhaben will. Sie haben ihn in ein Grab gelegt, hierzulande sind das Höhlen. Sie werden mit einem Stein verschlossen. Eher einem Fels. Daran gibt es nichts zu rütteln. Seit drei Tagen liegt er da drin, eine ganze Ewigkeit also. Als Magdalena den Friedhof betritt, ist es noch früh. Der Horizont ist schwarz, nur ein paar Vögel versuchen, die Nacht zu verscheuchen. Auf dem Gras liegt Tau. Sie kann nicht sagen, was sie hier will. Warum sie gekommen ist. Hauptsache nicht länger herumsitzen und warten. Warten, dass ein Wunder geschieht. Sein Grab liegt ganz hinten, zwischen den Olivenbäumen. Ein schöner Ort zu Lebzeiten. Dort hätte es ihm gefallen, denkt sie und spürt den Stich, weil nichts mehr so ist, wie es normal war. Sie können sich nicht mehr verabreden, Brot und Wein auspacken, reden und lachen. Das Lachen fehlt ihr am meisten.
Ihre Füße streifen die feuchten Gräser. Jetzt müsste sie gleich da sein. Verunsichert bleibt sie stehen. Hat sie sich verlaufen? Nein. Da ist der Olivenhain, dort ist die Höhle. Nur der Stein ist weg. Dieser Fels. Jemand hat ihn zur Seite gewälzt, als hätte ein Riese seine Hände im Spiel gehabt. Die Höhle liegt offen und schwarz vor ihr. Sie schrickt zurück und zögert, aber dann setzt sie einen Schritt ins Dunkle. Dann noch einen. Ihre Augen müssen sich erst an die Schwärze gewöhnen, doch es bleibt dabei: Sie sieht nichts. Das Grab ist leer.
Magdalena stürzt hinaus, kopflos, wo haben sie ihn hingebracht? Tiefstehende Sonnenstrahlen blenden sie. Die Vögel halten den Atem an. Da hört sie ihren Namen. „Magdalena!“ Sie wendet sich um, eine halbe Drehung – und sieht ihn. Seine Augen leuchten, ihr Herz macht einen Sprung. Schon will sie zu ihm laufen, will ihn in die Arme schließen, doch er hält sie zurück: „Berühr mich nicht.“
Ich schrecke hoch. Im Zimmer ist es dunkel, meine Hand tastet nach dem Wecker. Zehn nach vier. Kein Olivenhain, sondern meine Zwei-Zimmer-Wohnung im dritten Stock. Es ist Woche vier der Pandemie, ich spüre schlafwarme Haut und denke: Ich will berührt werden. Nicht immer und nicht überall, ich bin nicht der Küsschen-hier, Küsschen-da-Typ. Aber Freundinnen würde ich gern umarmen. Dem Berater bei der Bank die Hand geben. Mit Freunden die Köpfe zusammenstecken, Schulter an Schulter sitzen. Und nun träume ich ausgerechnet in der Osternacht diesen Traum, und nicht mal der hat ein Happy End. Dabei habe ich eigentlich nicht viel übrig für die Hollywoodfilme mit ihren Geigen am Schluss, aber jetzt könnte ich ein Happy End wirklich brauchen.
Einmeterdreiundachtzig entfernt, am Fußende des Bettes sitzt Jesus und nickt: „Ich auch...“
Weiterlesen oder Weiterhören:
Ostermorgen

Steht einer im Licht
des allerersten Tages
zum Aufbruch bereit
Sagt: Halt nichts fest
und in meinen Händen
keimt eine Erinnerung
an Morgen
So frei

Einmal ging Jesus in die Wüste,
er musste etwas herausfinden,
er aß nicht, er sprach nicht, er schaute kein Netflix,
er twitterte nichts, vielleicht betete er.
Nach 40 Tagen war er hungrig
Und mit dem Hunger kam die Versuchung
Sie trug ein Regenbogenshirt
und ihre Stimme klang nach Mars Schokoriegel im Doppelpack:
„Wenn Gott wirklich mit dir ist, nimm dir was du brauchst
und lass diese Steine Brot werden.“
Aber Jesus schüttelte den Kopf:
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
sondern von Worten und Träumen, die aus Gottes Mund kommen.“
Die Versuchung gab nicht auf,
sondern nahm ihn ins Allerheiligste
und stellte ihn heraus aufs Höchste
und legte einen Glitter & Sparkle-Filter um ihn
dass er leuchtete, hell wie das Universum
und rief:
„Du bist der Größte! Zeig, was du kannst! Spring!
Steht nicht geschrieben, dass Engel dich auf Händen tragen?“
Aber Jesus stieß die Versuchung weg:
„Es steht auch geschrieben:
Du sollst Gott nicht auf die Probe stellen.“
Die Versuchung ließ noch immer nicht locker,
sie bot ihm alle Königreiche und das weltweite Netz,
und schenkte ihm 10 Tausend neue Follower auf Insta,
die berät wären, ihn anzubeten,
und ließ Likes und Konfetti regnen:
„Das alles“, rief sie, „gehört dir,
wenn du mich anbetest!“
Aber Jesus stemmte sich dagegen:
„Niemals! Ich will niemanden anbeten, außer Gott.
Ich bin so frei.“
Da gab sich die Versuchung geschlagen
und es kamen Engel und brachten Gin Tonic und Falafel
und ein frisches Hemd in Himmelblau.
nach Matthäus 4, aus der Wohnzimmerkirche auf Instagram am 26. März
Liebesglut

Der Papst sagt, er könne zwei, die einander lieben, nicht segnen, weil Gott ihren Sex nicht mag. Gott ist das unangenehm. Man könnte glatt den Eindruck bekommen, er drücke sich an fremden Schlafzimmerfenstern herum. Dabei drückt er sich höchstens in fremden Herzen herum, und die sind nicht mal fremd, sondern Zweitwohnsitze. Besonders da, wo die Liebe wohnt, ist er gern. Gott wärmt sich auf, bevor er weiterzieht zu den erloschenen Herzen. Dort bläst er in die Liebesglut, dass sie auflodern möge. Auch beim Papst schaut er immer wieder mal vorbei.
Sonntagssegen

Beim Aufwachen zu lesen
Bitte gönn dir was
das Konzert der Meisen
Milchschaumminuten
eine verlorene Uhr
Plüschgedanken
Der Himmel ist
ein Gemischtwarenladen
Er hat jetzt geöffnet
für dich
Vergiss nicht, was du willst

Lydia hat vier Sachen in ihrem Leben gelernt:
1. Wenn du Erfolg haben willst, brauchst du Kraft wie fünf Männer.
2. Du hast Kraft wie fünf Männer.
3. Vergiss die Kompromisse.
4. Vergiss nicht, was du willst.
Lydia will zusammen essen, Brot backen, Apfelbäume pflanzen und nach Gott Ausschau halten – denn zu vielen sieht man mehr. „Ich will beten und wenn es sein muss auch herumstottern, ich will zusammen singen, Lagerfeuer machen, das Sonderbare nicht scheuen, ich will fasten, Buttercremetorte backen und Buttercremetorte teilen, ich will feiern, Geschichten erzählen, Seelen trösten, Ja sagen, ich will helfen, handauflegen, zuhören, die Tür will ich weit öffnen, ich will träumen, ich will taufen, ich will den Himmel an die Wand malen. Ich will lieben, zusammengefasst.“
Da kann keiner nein sagen, und so wird Lydia die allererste Christin in ganz Europa, und die erste Gemeindevorsteherin, und die erste Bischöfin ist sie auch. Denn andere gibt es ja noch nicht.
Kleine Erinnerung zum Weltfrauentag aus: Eva und der Zitronenfalter. Frauengeschichten aus der Bibel
PS: Ich schreibe bis Ostern übrigens wieder täglich auf chrimonshop.de
Sonntagsstimmung

Sonntags bin ich der Mensch, der ich gern wäre. Die Zeit und ich sind uns ausnahmsweise einig: Es gibt nichts zu müssen. Allen Aufgaben gebe ich frei. Der Himmel steht offen, ich erhasche einen Blick, wie es sein könnte. Gott ist erleichtert, weil ich endlich gelöst bin. Eine Blume sagt: Riech mal. Ich mache ihr die Freude.
aus: Luft nach oben. Der Sonntagskalender
Alles offen
Jesus und Maria Magdalena

Sie ist unabhängig. Eben wie man das landläufig so meint: Unverheiratet, mit einem Konto ausgestattet, das sie selber füllt. Eine Bohrmaschine hat sie auch (nutzt sie aber ungern. Wegen des Lärms. Und so viele Löcher braucht man gar nicht im Leben).
Er liebt sie. Mehr als die anderen. Aber ein Paar sind sie nicht.
Sie haben nie zusammen geschlafen. Obwohl es Momente gab, in denen es folgerichtig hätte sein können. Als sie am See saßen und die anderen längst gegangen waren. Sie redeten, während der Mond seine Runde drehte, bis er hinter den Kiefern verschwand. Ich liebe es, sagte sie, wie du meine Geister vertreibst, durch die Nacht mit mir gehst.
Im ersten Licht des Morgens sind sie geschwommen, vielleicht waren sie nackt, sie hat es vergessen. Später saßen sie zusammen in einem Boot, Schulter an Schulter. Es war eng und nicht unangenehm. Ich liebe es, sagte er, dass du mich berührst.
Er mag ihre Nähe, die immer etwas Waches hat. Sie lässt sich nicht fallen. Er hat nie das Gefühl, der Stärkere sein zu müssen. Sie lehnen aneinander, mit den Füßen auf der Erde. Das Boot schaukelte, sie genossen die Wärme ihrer nackten Haut, Bein und Arm. Sie genossen einander, ohne etwas zu wollen. Falls sie es doch taten, behielten sie es für sich, um das andere nicht zu stören, das leicht war und ihnen Flügel gab. Sie lernten, dass man nicht alles mitnehmen muss, was sich anbietet. Manchmal findet sie ihn schön. Seine Augen würde sie unter allen Augen erkennen. Auch seinen Körper. Er ist glatt, wie Marmor. Aber das sagt sie ihm nicht. Stattdessen: Deine Füße liebe ich. Deinen Kopf liebe ich auch. Er mag ihre Schultern. Sie sind muskulöser, als man zunächst denkt. Sie ist keine Sportlerin, sie gehört nicht zu den Frauen, die diszipliniert und geplant vorgehen. Aber sie bewegt sich gern und er genießt es, ihr dabei zuzusehen. Ich liebe es, sagt sie, wie du mich ansiehst. Nie habe ich das Gefühl, ich müsste mich verstecken.
Ich liebe es, sagt er, wie du einen Raum betrittst und die Blicke nicht wägst. Wie du dein Ding machst ohne Furcht.
Ihr Lachen macht sie zu Verschworenen. Wenn sie reden, dann reden sie nicht nur mit dem Kopf, sondern mit allem. Manchmal räkelt er sich wie eine große, schwere Raubkatze, wenn er einen Gedanken verfolgt. Sie fürchtet nichts an ihm. Obwohl er scharf sein kann, sogar verletzend. Bei ihr ist er es nicht. Sie weiß nicht, warum. Dabei kann sie selber auch scharf sein. Und schroff. Er sieht es ihr nach. Sie brauchen nicht miteinander zu kämpfen. Es gibt nicht zu behaupten und nichts zu gewinnen. Sie kennen einander zu gut.
Ich liebe es, sagt sie, dass du mich sein lässt, wie ich bin. Das verwandelt mich.
Es heißt, dass sie viele Männer hatte. Viel ist eine schwammige Zahl. Sie liebt Worte mehr als Zahlen. Aber gegen Sex hat sie nichts einzuwenden. So ein Satz kann gegen sie verwendet werden. Es heißt, dass sie versucht hat, ihn zu verführen. Er aber nicht wollte. Er konnte ihr widerstehen. Ihr, der Versuchung. Obwohl es andererseits auch nicht schlimm gewesen wäre, wenn er nicht widerstanden hätte: Sex macht Männern zu echten Männern und Frauen zu fragwürdigen Frauen. Für alleinstehende Frauen wie sie ist das ein Dilemma: Zu viel Sex ist schlecht, kein Sex aber auch. Eine Frau ohne Mann, ohne Kinder muss unglücklich sein. Wenn sie nicht unglücklich ist, dann stimmt etwas nicht mit ihr.Sie weiß, dass die Leute so denken. Er weiß es auch. Aber es spielt keine Rolle. Ich liebe deine heilige Furchtlosigkeit, sagt sie. Dass du dich nicht sorgst, was die Leute reden.
Manchmal sind ihre Worte wie Küsse. Sie schmecken salzig und süß. Wie Honig-Erdnüsse, denkt sie. Er denkt an Krebsfleisch. Sie essen oft zusammen. Ungeplant, Zufallsessen auf eine beiläufige, verschwenderische Art. Er brät ein Ei und sie öffnet eine Flasche Wein. Dabei reden sie weiter, kauen die Worten oder lassen sie auf der Zunge zergehen. Ich liebe es, sagt er, dass du eine Verschwenderin bist. Du rechnest nicht. Du wärst so eine schlechte Buchhalterin. Selber, denkt sie und lächelt in sich hinein.
Sie zeigen einander viel. Er lernt ihre Dämonen kennen und hält ihnen stand. Zum ersten Mal hat sie das Gefühl, sie nicht verteidigen zu müssen. Er würde nichts gegen sie verwenden. Dafür bleiben sie sich fern genug, sie müssen einander nichts heimzahlen. Auch sie ahnt etwas von seinem Schmerz. Obwohl er ihn nie zur Schau stellt. Auch von seiner Wut. Wie ein Sommergewitter bricht sie manchmal herein, unerwartet und heftig. Aber sie fürchtet sich nicht vor Gewittern.
Ich liebe es, sagt er, dass du mich nicht festnagelst.
Ich liebe es, sagt sie, dass du dich mir zeigst.
Ich liebe dich, sagen sie und lassen alles offen.
aus: Kirschen essen. Liebesgeschichten aus der Bibel. Edition chrismon
Lichtmess

Um acht ist es hell. Ich feiere das Licht und die Fresien auf der Fensterbank. Im Erwachen gibt es einen virusfreien Raum.
Meine Träume haben mittlerweile Handtaschenformat,
ich trage sie überall mit hin. Der Himmel ist noch unentschlossen, aber ich bin bereit.
Hellsehen

Wir sind da, Gott
auf dem Sofa,
in Flauschpantoffeln oder Lackschuhen
Wir haben die Perlen für dich angelegt
das Haar gescheitelt
das Hemd geknöpft
du siehst uns
Unsere Blicke gehen ins Schwarze
und über das Schwarze hinaus
Unsere Blicke kreuzen sich in einem virtuellen Raum
Du bist längst dort
Du hörst
wie unsere Herzen schlagen
du hörst die Nachbarn nebenan
und die Kinder, die nicht müde sind
und das Schweigen in den Konzertsälen hörst du auch.
Ich zeig euch was, sagst du.
Ich zeig euch, wie man hellsieht.
Amen
Gestern haben wir zum ersten Mal Wohnzimmerkirche auf Instagram gefeiert. Ein Prost auf Käsebrot, große Schwestern, Ausbruchsmomente, weiße Kleider, königlich sein und das Sekundenglück, das bereit liegt, wenn wir es sind. @wohnzimmerkirche
Januarmorgen

Noch ein grauer Januarmorgen. Schneereste auf dem Dach. Ich hab die Kerze im Fenster angezündet. Darauf ging gegenüber der Stern an. Vor ein paar Tagen hat mir die Frau mit dem Baby zugewinkt. Leben wie im Setzkasten. Ich mag das. Gott wohnt wahrscheinlich in der Wohnung mit der Amaryllis. Es ist nie jemand zu sehen, aber viel Papierkram auf dem Tisch. Über der Amaryllis hängt ein Herz. Es ist ein bisschen kitschig. Aber auch schrebbelig, ein Geschenk, das hängengeblieben ist. Irgendwann werde wir gleichzeitig aus dem Fenster sehen.
Barmherzigkeit

Ich bin Bonbonzerbeißerin. Ich weiß, das ist eine schlechte Angewohnheit, meine Zahnärztin liest hoffentlich nicht zu. Was ich noch bin: Große Schwester. Steuerzahlerin. Überzeugte Bahnfahrerin. Hoffnungsvolle Optimistin. Ich habe viele Facetten. Wie jeder Mensch. Ich finde es eine erleichternde Vorstellung, dass es bei allen Menschen etwas geben könnte, das uns verbindet. Man muss nur lang genug suchen. So würde ich mit Herrn Trump politisch wahrscheinlich nicht einig werden. Aber vielleicht teilen wir eine Vorliebe für Minzschokolade.
Leider geht es im Leben nicht nur um Süßigkeiten. Rassistische oder andere verachtende Haltungen möchte ich nicht kleinreden. Dennoch bleibt eine Gemeinsamkeit: Wir sind Menschen. Dieser kleinste gemeinsame Nenner besteht, er bleibt sogar dann bestehen, wenn Menschen unmenschlich handeln. Sie bleiben Menschen, weil Gott sie als solche erschaffen hat. Der erste Tod in der Bibel ist ein Mord. Kain erschlägt seinen Bruder Abel und darf trotzdem weiterleben. Gott verurteilt sein Tun, aber schützt ihn als Mensch. Ein altes Wort dafür ist Barmherzigkeit. Es ist staubig geworden, dabei ist es ein schönes Wort. Es wärmt und verwandelt. Wer mutig ist, bläst den Staub weg und lässt es wirken. Nimmt sich ein Herz für die Herzlosen und die Feindseligen. Für einen allein ist das vielleicht zuviel. Aber zusammen könnte es uns gelingen, darauf zu bestehen, dass Menschlichkeit siegt.
Wo Gott wohnt (wenn Sommer ist)

Ich glaube, du hast eine Höhle im Wald
irgendwo im Unterholz
dort lebst du mit Ameisen und Feuerwanzen
die versuchen dich nicht einzusperren
und sind gesellig
Größe spielt keine Rolle
- soweit ich weiß -
Manchmal kommt eine Spitzmaus vorbei
Ich glaube
selbst Menschen
sind willkommen
Lustprinzip
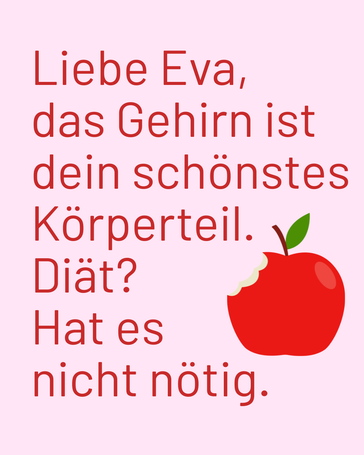
Liebe Eva,
ich bin Susanne. Ich mag Himbeeren und Gendersternchen und dich. Wenn ich an dich denke, denke ich an Emanzipation. Das Wort hast du erfunden. Ich seh dich, wie du auf der Schwelle stehst. Nach
draußen, ins Freie. Die Sicherheit lässt du zurück. Aber hej, denke ich - fürchte dich nicht. Gott hat die Sehnsucht in unser Herz gelegt. Nicht die Schuld. Lass dir das nicht einreden, auch in
hunderttausend Jahren nicht. Männer haben das lang genug versucht, um die Welt zu beherrschen und die Frauen dazu. Hier ist dein Platz, haben sie gesagt und die Mauern immer enger gezogen, bis
das Paradies nur noch vom Herd bis zur Wiege reichte.
Wenn es gut läuft, wirst du als Mutter aller Menschen bezeichnet, das ist auch so ein Ding: Wenn schon Frau, dann wenigstens Mutter. Okay, dann sage ich es mal so: Du hast uns die Lust am Denken
in die Wiege gelegt. Die Lust, zu fragen: Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum – wer nicht fragt, bleibt dumm.
Das Gehirn ist dein schönstes Körperteil. Diät? Hat es nicht nötig.
Es gebiert die Phantasie, die vorwegnimmt, was noch nicht ist, aber sein könnte. Und dazu haben wir ein funktionsfähiges Gewissen bekommen und ein Herz voll Empathie. Du bist nicht die einzige auf der Welt. Adam steht an deiner Seite, und das ist gut. Besser ist es zu zweit und eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell. Ich bin eure Verbündete, und ich hab Lust. Weiterzudenken. Ich hab Lust, die Welt zu erforschen. Es gibt so viel zu entdecken. Amen, sagt Gott. Und gibt uns Proviant für unterwegs: Drei Äpfel und einen Sack Vertrauen.
aus: Drei Briefe an Eva. Wohnzimmerkirche, Lustprinzip
Mai!

Ich war mal Maikönigin. Also nicht offiziell, nicht mit Schärpe und Presse und Trallala. Es war einer dieser Tanz-in-den-Mai-Feiern, die man damals noch Feten nannte, und wir waren ziemlich unter uns. Irgendwo in der Nähe von Steinhude, falls euch das was sagt. Mein Ruhm währte kurz, ich nehme an, von Mitternacht bis zum Morgengrauen, was aber überhaupt nichts machte. Schließlich erinnere ich bis heute daran, wie das ist: Einmal Königin sein. Nicht, weil ich die Schönste war (war ich nicht). Nicht, weil ich am besten tanzen konnte (konnte ich nicht). Nicht, weil mein Vater bereits König war (eher Bauer). Ich hatte zufällig am überzeugendsten ein paar Scherzfragen beantwortet. Keine große Sache. Was ich sagen will, ist: wie gut sich das anfühlt, für einen Moment zu glänzen. Bejubelt zu werden, ganz ohne Grund. Kurz genug, damit es nicht zu Kopf steigt. Lang genug für das
Gefühl: Du bist wer. Du zählst. Sagt Gott, immer wieder, lebenslang. Sollten wir so oft es geht weitersagen. Zum Beispiel heute Nacht: Setzt doch mal jemandem eine Krone auf. Und tanzt, schwebt, stolpert, lauft zusammen in den Mai.
Als Frau Meckelbach aufersteht

Als Frau Meckelbach aufersteht, blühen die Narzissen. Im Grab ist es zu eng. Frau Meckelbach, litt Zeit ihres Lebens an einer leichten Form von Platzangst. Sie verlässt den Sarg und staunt, wie das möglich ist. Schließlich hat Egon massive Eiche gewählt, das, fand er, war er seiner Gattin schuldig. Und dann liegt ja auch noch eine Tonne Erde über ihr, ein unter normalen Umständen beängstigender Gedanke. Aber normal ist nichts mehr. Frau Meckelbach gleitet hinaus, ins Freie, ihren Körper lässt sie zurück. Ein kurzes Bedauern flammt in ihr auf, denn schließlich waren sie lange miteinander unterwegs gewesen. Andererseits gehörte Frau Meckelbach nie zu denen, die jedes Kleid aufheben müssen, weil es ja sein könnte, dass man es noch mal tragen würde. Nach einer Diät. Oder wenn die Mode wechselt. Frau Meckelbach braucht ihren Körper nicht mehr. Frau Meckel wird nie wieder Diät machen, sie atmet auf. Atmen funktioniert überraschenderweise. In ihrem Inneren ist ein so ungeheurer Drang nach Luft. Frühlingsluft. Sie saugt sie in sich ein, dass sie zu schweben beginnt, hinauf, hinauf, bis an die Grenzen der Vorstellungskraft. Und darüber hinaus.
Sturm. Wutbürgerinnen und Moralapostel

Morgens um halb zehn geht das Volk auf die Straße. Morgens um halb zehn sieht Herr Müller rot. Herr Müller ist wütend und brüllt. Zusammen mit den anderen. Hat einen Galgen gebaut, hat Bilder von Politikern drangehängt. Herr Müller ist enttäuscht, fühlt sich verraten und verkauft. Sein Gesicht ist hassverzerrt. Dabei ist er sonst ganz lieb und geht sonntags mit den Kindern in den Zoo. Herr Müller kann tausend Namen haben, Hans-Martin oder Kevin. Bill oder Claudia oder Salim.
Herr Müller lebt überall auf der Welt. Herr Müller ist tausend mal tausend Jahre alt. Herr Müller war auch damals dabei, an jenem Freitag und hat Jesus durch die Straßen getrieben, hat geschrien: „Tötet ihn! Tötet ihn!“ Damals hieß Herr Müller vielleicht Hanna oder Thomas. Herr Müller kannte Jesus nicht persönlich. Anfangs fand er ihn ganz gut. Weil der gesagt hat: „Ich ändere was. Echt. Himmel auf Erden, die Letzten werden die Ersten sein!“
In Herrn Müller war so eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, wobei er das nie so formuliert hätte. Aber dass etwas falsch läuft, das war eindeutig. Damals und heute und immer wieder: Die Reichen sind zu reich und die Armen zu arm. Die Mächtigen sind zu mächtig, und einer wie Herr Müller ist zu ohnmächtig. Und diese Ohnmacht, die macht ihn rasend. Und deshalb hat er zugehört, als Jesus redete. Hat an seinen Lippen gehangen und gesehen, wie 5000 Leute mucksmäuschenstill waren und satt wurden. Leute wie er. Ganz normale Leute.
Und jetzt läuft Herr Müller durch die Straßen und schreit. Wie konnte es bloß soweit kommen?
2000 Jahre und einen Tag zurück. Donnerstagmorgen:
Judas hat sich entschieden. Irgendwer muss handeln. Immer nur reden, reden, reden. Das führt zu nichts. Judas ist kein Hitzkopf und auch kein böser Mensch. Aber in seinem Bauch brodelt es. Judas
lebt in einem besetzten Land. Steuern und Zölle sind hoch. Die Korruption blüht. Immer wieder gibt es Aufstände, die brutal niedergeschlagen werden. Propheten versprechen ein neues
Zeitalter.
Einer dieser Propheten ist Jesus. Ihm hat Judas sich angeschlossen. Und jetzt ist er enttäuscht, genau wie Herr Müller. „Jesus?“, würde er sagen, wenn wir ihn fragen könnten. „Ist genau wie alle
anderen. Nichts als leere Versprechen.“ Dabei hatte er von ganzem Herzen an ihn geglaubt. Dass eine andere Welt möglich sei. Judas wollte den Umsturz der Verhältnisse. Wollte die Besatzer zum
Teufel jagen. Wollte, dass etwas ganz Großes passiert. Etwas, das alles ändert.
Jetzt ist Schluss. Jetzt nimmt er die Sache selbst in die Hand. Judas verrät, wo Jesus sich aufhalten wird in dieser Nacht. Verrät, wo sie essen werden, verrät, was er liebt. Kassiert ein
Säckchen Silber dafür (aber es geht ihm nicht ums Geld). Judas verrät Jesus und setzt auf Eskalation. Damit Jesus zeigen kann, wer er wirklich ist. Damit der Sturm losbricht.
Donnerstagabend:
Die Kerzen brennen noch. Noch schimmert der Wein im Glas. Noch sind sie alle zusammen. Da sagt Jesus: „In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern über mich.“ Werdet euch abwenden, irre werden,
werdet verletzt sein, beleidigt. Als sie das hören, bleibt ihnen der letzte Bissen im Hals stecken. „Ich niemals!“, ruft Petrus und braust wie immer ein bisschen auf. Aber Jesus redet einfach
weiter: „Die Menschen werden euch hassen, weil sie mich hassen.“ Die Worte stehen wie Gewitter im Raum. Aber noch entlädt sich nichts. Wieso Hass?, denkt Petrus. Woher kommt dieser Hass?
Alle schlafen. Obwohl man jetzt wach sein müsste. Der Sturm zieht auf. Seit Tagen schon. Wer Ohren hat, der höre. Zusammen könnte man das Schlimmste verhindern. Aber so schlimm wird es schon
nicht werden, oder? Es wird schon gut gehen. Ist bisher immer gut gegangen. Alle schlafen, Jesus betet. Allein. Beten ist Protest, der zum Himmel schreit. „Wacht auf!“, möchte man den anderen
zurufen. „So wacht doch auf, ihr Narren! Habt ihr schon vergessen, was mit Johannes dem Täufer passiert ist? Habt ihr vergessen, wie sie seinen Kopf auf einem Tablett präsentiert haben? Das ist
kein Einzelfall.“
Mitternacht:
Sie kommen. Sie kommen, ihn zu holen. Mit Schwertern und mit Stangen kommen sie. Petrus will kämpfen. „Was auch immer geschieht, ich halte zu dir“, hatte er versprochen. Jetzt ein Held sein, er
zieht die Klinge und sticht zu – aber Jesus greift ihm ins Messer. „Lass gut sein“, sagt er. „Steck die Waffe weg. Du wirst wen verletzen.“ Und dann sagt er noch: „Wer zur Waffe greift, wird
durch die Waffe umkommen.“ Sie führen Jesus ab, und er geht mit, widerstandlos. Warum?, will Petrus schreien. Warum?, will Judas schreien. Wo ist das Wunder, das du versprochen hast?
Freitag in aller Frühe:
Der römische Statthalter Pilatus verspeist ein Hühnerbein, als sie ihm den Angeklagten bringen: Störung der öffentlichen Ordnung. Aufwiegelung und Amtsanmaßung. Darauf steht die Todesstrafe.
Aufwiegler werden gekreuzigt. Das schreckt ab. Pilatus will die Sache schnell erledigen. Hauptsache kein Aufruhr. Denn Pilatus will Karriere machen. Der Rest ist ihm herzlich egal.
Pilatus mustert diesen Jesus. Er könnte ihn retten. Das wär mal was. Irgendwas imponiert ihm an dem. Stellt sich hin und sagt: Ich bin König. Drollig irgendwie. Tut keinem was zu leide. Das
bringt die Leute zur Raserei. Von draußen ist das Gebrüll zu hören. Pilatus befiehlt, die Fenster zu schließen. Er findet Kreuzigungen barbarisch. Etwas für den Pöbel.
Mit diesem Jesus könnte man sich vielleicht unterhalten. Er hält ihm ein Hühnerbein hin. Keine Reaktion. Schade. Wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, soll dieser Jesus dem Genuss nicht
abgeneigt sein. Und dabei als Redner talentiert. Etwas Abwechslung. Pilatus wischt sich die Finger an der Serviette ab und rülpst dezent. Die Schreie draußen werden lauter. Nützt ja nichts, denkt
er und geht hinaus.
Freitag, kurz nach Sonnenaufgang:
Pilatus tritt vor die Menge. Eine anonyme Masse. Er hat aufgehört, in Gesichter zu sehen. Für ihn sehen sie alle gleich aus. Ihre Wut und ihr Hass schlagen ihm entgegen wie ein Feuersturm.
Pilatus kann das nicht nachvollziehen. Einer wie er braucht keine Wut. Er setzt ein gütiges Gesicht auf und bietet ihnen Gnade an. Großherzige Gnade: „Den da“, sagt er und zeigt auf Jesus, „oder
Barrabas. Wen soll ich laufen lassen?“ Jesus, den Rebellen, der an den Himmel glaubt, oder Barrabas, den verurteilten Verbrecher. Einen, der nicht mal Worte als Waffe benutzt, oder einen Mörder.
„Barrabas!“, rufen sie. Immer wieder: „Barrabas!“ Sterben soll der andere. „Was hat er getan?“, fragt Pilatus. Aber seine Frage geht unter im Geschrei des Mobs: „Kreuzigt ihn! Kreuzigt ihn!“
Barbaren, denkt Pilatus und geht hinein, um sich die Hände zu waschen.
Freitag, gegen Mittag:
Die Soldaten hämmern Nägel ins Kreuz. Mitten durch die Handgelenke, später auch durch die Fußgelenke. Sie können das gut, ihre Schläge sind schnell und kräftig. Die Schreie könnten Tote
aufwecken, aber sie hören sie nicht mehr. Der da ist nur noch ein Bündel Fleisch. Da, wo das Gesicht war, ist Blut. Die Folter gehört zur Strafe.
Sie haben getrunken, vielleicht sind auch Drogen im Spiel, das nimmt niemand so genau. Irgendwer muss die Drecksarbeit machen. Sie tun nur ihre Pflicht, und irgendwas wird schon dran sein.
Unschuldig sind die doch alle nicht. Außerdem gibt es Zulagen, sie spielen um die Kleider der Verurteilten, weil wer da oben hängt, der braucht nichts mehr zum Anziehen – die Blutflecken
kriegst du eh nicht mehr raus – haha! Wer die härtesten Witze macht, kriegt einen Schnaps.
Freitagnachmittag:
Jesus hängt am Kreuz. Die Menge hat sich zerstreut, der Sturm ist gestillt. Jetzt kommt nichts mehr, außer dem Tod. Die Frauen bleiben. Können nichts tun, aber bleiben. Die Frauen haben auch
Namen, das vergisst man schnell. Dreimal Maria: Seine Mutter. Seine Tante. Und Maria aus Magdala, seine – was eigentlich? Vertraute, Geliebte, Freundin, Verbündete? Sie laufen nicht weg. Es ist
nicht ungefährlich, was sie tun. Man sympathisiert nicht mit Rebellen. Dennoch bleiben sie. Das Dennoch ist ihr Protest. Sie können nichts tun, außer da sein. Das ist so ein Frauending, sagen die
einen. Mitleid nennen es die anderen. Wo ihre Wut ist, wissen wir nicht. Sie ist nicht zu sehen. Vielleicht hat sie sich verwandelt: zu Mut in kleinen Portionen.
Später:
Jesus schreit. Das will man nicht hören. Helden sterben lautlos. Aber Jesus schreit. Schreit seine Ohnmacht heraus. Wo sind die Freunde? Pilatus isst das letzte Hühnerbein. Die Soldaten haben
Feierabend. Der Hass kommt vorbei und lästert: „Hilf dir doch selbst. Zeig, was du kannst.“ Jesus schreit. Meine Wut stimmt ein.
Noch später:
Jesus stirbt. Der Himmel verdunkelt sich.
Gott schweigt. Ewig und drei Tage.
Dann wischt Gott das Blut auf.
Malt damit ein Herz.
Gott sieht rot. Morgenrot.
Am Morgen danach tritt Herr Müller auf die Straße. Es ist still, sehr still.
„Wut“, sagt Gott. „Kenne ich.“
„Du?“, fragt Herr Müller.
„Wut ist enttäuschte Liebe“, sagt Gott. „Aber wer wütend ist, ist noch lebendig. Wer wütend ist, ist noch nicht kalt. Wer wütend ist, dem ist noch nicht alles egal. Du kannst die Wut
zurückverwandeln.“
Herr Müller weiß nicht so recht, wie das gehen soll.
„Durch Übung“, sagt Gott. „Liebe ist die einzige, die dich retten kann. Such nicht im Sturm. Such nicht im Feuer. Warte nicht auf das große Beben. Ich bin der stille, sanfte Hauch.“
Herr Müller ist nicht gut im Spüren. Aber irgendetwas geht ihm gerade unter die Haut.
Kann man auch hören: Gesendet am Karfreitag im Deutschlandfunk, 18. April 2025 ,
Kara (Kummer, Klage)
Gott ist gestorben.
Mit schwarzen Flügeln fliegt er davon.
Ich bleibe zurück, unruhig,
weil ich nicht weiß, was jetzt zu tun ist.
Wer kümmert sich um die Wildgänse auf den Wiesen?
Wer weiß, wie man ein Herz flickt?
Wer bestellt den Regen?
Wer backt das Brot?
Am Boden ist Totenstille.
Selbst der Wind hält die Luft an.
Du musst atmen, sagt Gott.
Damit sich etwas bewegt.
Selig sind die Narren

Als Jesus kommt, gucken alle erstmal in die falsche Richtung. Weil, ein König müsste doch mit einem Privatjet kommen oder mindestens mit einer Limousine (nur Tesla geht jetzt nicht mehr). Vielleicht auch mit der Bahn, weil Jesus so einen Ruf als Öko hat, dann aber wenigstens erste Klasse. Nur: Da kommt nichts. Am Horizont gähnende Leere. Bis von der anderen Seite ein Esel herantrottet, gemächlich, weil hier und da sich noch ein Löwenzahn zum Fressen anbietet.
So ein Esel ist sich der Tragweite seiner Rolle nicht bewusst.
Er versteht auch nicht zu glänzen wie ein Pferd. Aber zum Glück ist sein Reiter geduldig. Wobei – er reitet ja gar nicht. Er sitzt. Besonders majestätisch wirkt das nicht; sitz mal auf einem Esel, die Beine baumeln ins Nichts, und das Tier tut sowieso, was es will. Du brauchst gar nicht erst versuchen, es zu beherrschen. Du kannst froh sein, wenn es läuft. Jesus sieht aus, als koste er die Verwirrung aus. Der Esel trottet am roten Teppich vorbei. Ein Staatsbesuch sieht anders aus, die Anzugträger wissen nicht, wohin mit sich, und auch der Herr Bischof zögert, seinem König zu folgen, wegen der italienischen Schuhe, die sehr empfindlich sind.
Die Leute aber ziehen ihre Jacken aus, werfen Schal und Hemd auf die Straße, brechen Zweige von den Bäumen, jubeln, streuen Blüten und feiern ihn. Sie haben so die Nase voll von den Eitelkeiten der Oberhäupter, Hosianna, rufen sie. Endlich einer, der sich nicht so wichtig nimmt.
In den Abendnachrichten kein Wort von ihm, nur Krieg und Kämpfe um Macht und Eier, und ein paar Gockel sind auch zu sehen. Aber wer will sich das schon anschauen? Das Leben findet woanders statt. Selig sind die Narren, ruft Jesus, denn sie werden die Ordnung auf den Kopf stellen. Ihnen gehört das Himmelreich! Ob das zu sagen nicht gefährlich sei, fragen einige. Man höre immer häufiger von Zensur, von Repressionen, von Schlimmerem, mit dem zu rechnen sei.
Aber sowas hat Jesus ja noch nie gestört.
Wenn die Welt wankt

Ich mag das rote Radio in meiner Küche. Ich mag den Schaukelstuhl und das glitzernde Kaninchen, das auf meinem Schreibtisch steht. Aber lebenswichtig ist das alles nicht. Bisher musste ich mir noch nie ernsthaft und existenziell die Frage stellen, was lebenswichtig ist. Zum Glück. Weil ich in einem Land lebe, das so stabil ist, dass ich keine Bombe fürchte, die mir aufs Dach fällt. Weil ich nachts ruhig schlafen kann, ohne dass marodierende Gangs durch die Straßen ziehen. Weil es bei allem, was schiefläuft, Rechtstaat, Demokratie und eine freie Presse gibt. Und Erdbeeren vom Markt. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann ist es die Sicherheit, dass das so bleibt.
„Sorry“, sagt Gott. „Sicherheit gibt es nicht. Was ich dir anbieten kann, ist Vertrauen.“
Das hätte ich mir denken können. Sicherheit versprechen nur die Profiteure der Angst. Aber Vertrauen? Worauf?
„Du bist nicht allein“, Gott sagt. „Erstens bin ich bei dir. In dir drin. Ob du’s glaubst oder nicht. Und zweitens sind da die anderen: Freundinnen und Verbündete. Nachbarn und Zufallsbegegnungen. Eine Tante, die wiederauftaucht oder der freundliche Käseverkäufer auf dem Markt. Wenn die Welt wankt, hilft es, sich aneinander festzuhalten.“
„Amen“, sage ich. Unsicher, aber mutig. Zusammen bleiben wir stabil.
Zuversicht

Der Himmel strahlt heute eine gewisse Zuversicht aus,
sage ich.
Jonte nickt. Eine Möwe fliegt vorbei.
Die Möwen, sagt Jonte, sind die Seelen der Matrosen.
Die Möwe kackt auf seinen Kopf. Zum Glück trägt er Mütze.
Die Seele muss sich auch mal erleichtern, sage ich.
Isso, sagt Jonte.
Und dann schweigen wir wieder.
Kurz mal zu Jesus

Kurz mal zu Jesus. Das ist der mit dem Kreuz. Wegen ihm gibt es eine ganze Religion, genau, das Christentum.
Jesus ist schon eine Weile tot. Genauer gesagt: Er wurde getötet. Gekreuzigt. Das war damals eine typisch römische Strafe für Schwerverbrecher. Jedenfalls solche, die keine römischen Bürger waren. Eine Foltermethode, langsam und grausam. Ich glaube nicht, dass Jesus aus freien Stücken gesagt hat: Klar, mache ich. Jesus wurde hingerichtet, weil er unbequem war. Er hat die bestehende Ordnung und Hierarchien in Frage gestellt, er hat Massen mobilisiert (mal vier-, mal fünftausend). Er hat Freiheit für Gefangene und Unterdrückte gefordert. Er wollte die Welt gerechter machen.
Damit seine Botschaft weiterlebt, gibt es die Kirche.
Die Kirche war eine Untergrundorganisation.
Das vergisst man manchmal. Anfangs gab es keinen Reichtum, keinen Prunk, keinen Einfluss. Anfangs war es richtig gefährlich, dabei zu sein. Heute sagen Manche: Die Kirche soll dekorativ sein und Amen sagen und nicht weiter stören. Vor allem soll sie sich nicht in Politik einmischen. Jesus hat ziemlich gestört. Die Mächtigen und die Reichen, er hat die Unterdrücker beim Unterdrücken gestört. Und Männer, die gern vergöttert werden wollten, hat er auch gestört. Eigentlich war das meiste, was er gesagt hat, unbequem und sehr radikal: Liebe deine Nächsten (auch wenn sie anders leben als du). Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. (Warum besitzen einzelne Menschen Milliarden?) Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. (Autsch.) Die Liste lässt sich fortsetzen, nachzulesen in den Evangelien.
Was Jesus sagt, ist unbequem.
Damals wie heute. Die Überlieferungen sind 2000 Jahre alt. Manches wurde nachträglich bearbeitet oder zugefügt. Und natürlich lässt sich nicht alles eins zu eins auf unsere Zeit übertragen. Aber die Botschaft von Jesus bleibt: Ich bin nicht gekommen, Harmonie zu verbreiten, sondern Streitgespräche zu führen. Mischt euch ein. Eine andere Welt ist möglich: Wie im Himmel so auf Erden.
Wer Kirche will, muss mit Jesus klarkommen. Und wer Jesus will, kann nicht zu allem Ja und Amen sagen.
Herzmuskel

Diese Woche ist der Himmel blau und ich gehe wählen.
Am Wochenende hätte meine Oma Geburtstag gehabt, sie wäre dann 103 geworden. Ich hoffe, es gibt Torte im Himmel, denn meine Oma war die Königin der Torten. Torte gab es zu wichtigen Anlässen und
Anlässe hatten für meine Großeltern eine Bedeutung. Der Wahlsonntag war einer davon. Ich sehe sie, wie sie ihre Mäntel anziehen und Hut aufsetzen. „Was wählt ihr?“, habe ich als Kind gefragt.
Wählen schien eine geheimnisvolle und aufregende Sache zu sein. Meine Großeltern erklärten mir, was ein Wahlgeheimnis ist und warum das was mit Freiheit zu tun hat. Denn sie hatten erlebt, wie es
ist, wenn die Demokratie stirbt. Mein Opa konnte sich über das Gebrüll eines Hitlers ereifern, er hat später viele, viele Dokumentationen geschaut. Auch mit mir. Manchmal schüttelte er sich.
Wieder und wieder fragte er: Wie konnten wir so verblendet sein? Wieso haben wir das zugelassen? Willst du mit solchen Leuten am Kaffeetisch sitzen?
Vielleicht ist das nicht das entscheidende Wahlkriterium, aber ein Gradmesser ist es schon: Mit wem würde ich Omas Torte teilen? Sicher nicht mit den Lautesten. Sicher nicht mit Schreihälsen, die
ihre Häme und Hetze über Omas Kaffeetisch ausschütten. Solchen Leuten traue ich auch sonst nichts Gutes zu.
Postkarte: www.editionahoi.de
Heiliger Schrecken

Frau Immergrün zieht sich zurück. Ins Private. „Das kann man ja nicht aushalten“, sagt sie und meint: was in der Welt geschieht. All die Männer, die so tun, als seien sie der Heiland persönlich.
Seit neuestem gibt es auch Frauen unter ihnen. Anfangs hat sie noch demonstriert, gegen die AFD und ihre Hetze, für Klimaschutz und Weltfrieden. Sie hat Kerzen angezündet und mit Engelszungen
geredet. Sie hat auf die Vernunft gesetzt: die USA würden doch nicht wirklich ein zweites Mal Trump als Präsident wollen? Sie wollen. Zusammen mit den reichsten Männern feiert er sich. Und zu
allem Überfluss klebt seit gestern am Briefkasten ihrer Nachbarin ein Sticker mit der Aufschrift „Biodeutsch statt Bio-Fleisch“.
Frau Immergrün ist so müde.
Sie will sich die Decke über den Kopf ziehen und erst wieder aufwachen, wenn die Welt wieder in Ordnung ist. Wenn man ohnehin nichts ändern kann, kann man es auch sein lassen. Selbstfürsorge sei
in diesen Zeiten wichtiger denn je, hat Frau Immergrün gelesen und plötzlich eine so unglaubliche Sehnsucht nach Flausch gespürt. „Ich kapituliere. Ab sofort halte ich mich raus. Statt
Nachrichten schaue ich nur noch Panda-Videos.“
„Aber nein“, sagt Gott, „tu das bitte nicht!“, (und es ist wirklich selten, dass Gott sich einmischt).
„Du!“, ruft Frau Immergrün, „du hast mir gerade noch gefehlt. Du könntest ja was unternehmen. Könntest durchgreifen und die Welt wieder ins Gleichgewicht bringen. Da schwadroniert ein selbstverliebter Präsident, von Gott selbst auserwählt zu sein und du – schweigst.“ Frau Immergrün ist überrascht, wieviel Wut sich in ihr angestaut hat.
Gott versteht das. Aber Gott ist kein Schlägertyp: „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“
Dann ist es still. Nicht mal die Fliege am Fenster wagt es, ihre Flügel zu spreizen. Man könnte meinen, die Welt bliebe stehen. Aber so einfach geht das natürlich nicht. Frau Immergrün schüttelt
ein Kissen auf und überlegt, ob die Wand eine neue Farbe vertragen würde. Irgendwas in Pastell. Gott geht nicht weg. Gott bleibt. Und sagt: „Ich brauche dich. Bitte. Lass mich nicht allein mit
diesen Möchtegern-Göttern, mit ihrem Egoismus und Größenwahn.“
Frau Immergrün hört plötzlich den Schrecken in Gottes Stimme. Und da besinnt sie sich: Nein, denkt sie. Nein, das kann ich dir wirklich nicht antun.
erschienen in: Innehalten_Magazin
Nachhilfe

Hallo Jesus,
du hast geglaubt:
eher kommt ein Kamel durchs Nadelöhr
als ein Reicher in den Himmel.
Du hast gesagt:
Ich bin fremd gewesen
und ihr habt mich aufgenommen.
Du hast geträumt:
von einer Welt, in der Liebe regiert.
Klappt gerade nicht so.
Gib uns Nachhilfe,
wir bleiben dran.
Friedenspfeife

Die Welt ist voll Übel und heimlich wünsche ich mir manchmal, Gott würde durchgreifen. Weil ich selber nicht weiterweiß. Ich sage das natürlich nicht laut, denn ich glaube ja eigentlich nicht an Allmacht. Wenn es sie gäbe, hätte sie in jahrtausendlanger Geschichte ziemlich versagt. Trotzdem sterben Allmachtsfantasien nichts aus. Ein starker Mann soll es richten (wenn es sein muss, auch eine starke Frau). Das ist gerade unglaublich populär. Dass es starke Männer waren, die die schlimmsten Kriege entfesselt haben, ist eine Ungereimtheit, die dabei nicht weiter zu stören scheint.
Eine Seite von mir will also einen mächtigen Gott.
Er soll regeln, was die Weltgemeinschaft gerade nicht hinkriegt. Das wollen die anderen auch, die nennen Gott Trump oder Trump Gott, die Grenzen scheinen da fließend zu sein. Seit neuestem betrachtet sich auch Alice W. als inkarnierte Liebe. Das ist natürlich ein Fake-Profil, die Liebe tritt zwar in vielerlei Gestalt auf, ganz sicher aber hetzt sie nicht, hasst nicht, lügt nicht. Die Liebe ist, anders als die Äußerungen von Alice, freundlich, sie ereifert sich nicht, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen. Der Liebe geht es nicht um Macht, sondern um Miteinander.
Jesus raucht eine Friedenspfeife aus Zucker und sagt: „Gott ist die Liebe, also wird das mit dem Durchgreifen nichts.“ Ich sage: „Schade“, und Jesus sagt: „Macht nichts, Gott ist in den Schwachen mächtig.“ Ich wende ein, dass Schwäche gerade nicht so gut ankommt. Jesus sagt, Schwäche sei noch nie gut angekommen. Damit kenne er sich aus. Die eigentliche Stärke läge darin, das auszuhalten. „Aber Liebe heißt nicht, alles zuzulassen. Weil dann aus Liebe Missbrauch wird.“
Dann bietet er mir einen Zug aus seiner Pfeife an. Ich schüttele den Kopf, weil ich keinen Zucker esse. Er nickt und lächelt, mit so viel Verschiedenheit können wir leben.
Kinderspiel

Als am 24. Dezember der Krieg fortgesetzt werden soll, geht Marie in die Kommandozentrale des Heeres und sagt zu ihrem Gatten, dem General: »Hier, dein Kind.«
Sie legt den Säugling in seinen Arm, händigt ihm ein Fläschchen trinkwarme Milch, Windeln und ein Plüschkrokodil aus. Der General ist so überrascht, dass ihm kein einziger Befehl einfällt: »Aber wie stellst du dir das vor? Ich kann nicht, ich habe zu tun!«
»Ich auch«, erwidert Marie. »Du bist dran.«
Die Tür schließt sich hinter ihr, und da steht der General mit einer Packung Windeln und einem Plüschkrokodil und bevor er sich einen Überblick über die Lage verschaffen kann, beginnt das Kindlein erst zu jammern, dann zu schreien, sodass es dringend herauszufinden gilt, wie es zu beruhigen ist. Bei dieser Art von Lärm lässt sich unmöglich ein anständiger Krieg führen. Das Kind muss befriedet werden. Was nicht unbedingt zu den Kernaufgaben des Generals gehört. Außerdem kommt es sehr ungelegen. Krieg ist schließlich kein Kinderspielplatz und der Gegner wartet nicht, bis ein Säugling gewickelt ist.
Eine Tagesmutter aufzutreiben, erweist sich in der Eile als aussichtslose Mission. Tagesmütter gehören nicht zum Profil einer Armee, weswegen der General den Gefreiten Kösters zur Betreuung abkommandiert. Überraschenderweise ist der Gefreite nicht abkömmlich. Er hält bereits selber zwei Babys im Arm. Zwillinge, geboren am Nikolaustag. Überdies habe auch der Feind Probleme mit Babys. Ob man die Schlacht verschieben könne, am besten auf die Stunde während des Mittagsschlafs, dann allerdings ohne schweres Geschütz, um die Kleinen nicht zu wecken. Schlecht gelaunte Säuglinge stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. An ein geordnetes Kriegsgeschehen ist nicht mehr zu denken. Aufklärer des Heeres bringen übereinstimmende Kunde: Sämtliche Frauen inner- und außerhalb der Landesgrenzen seien aufgebrochen und haben den Männern Babys in die Arme gedrückt: »Hier ist dein Kind. Hier ist deine Nichte, dein Neffe. Brüderchen und Schwesterchen.« Nach Angaben des Geheimdienstes liegen nun Hunderte, nein Tausende Säuglinge in Uniformsarmen, um gefüttert, gewickelt, gewiegt zu werden. Auch Terroristen und Söldner, so hört man, seien außer Gefecht gesetzt und haben alle Hände voll zu tun, um Milch zu wärmen und hungrige Münder zu stillen, sodass an einen anständigen Krieg überhaupt nicht mehr zu denken ist.
Der General ist außer sich. Auf eine derartige Situation ist er nicht vorbereitet. Es bräuchte einen Krisenstab, aber im Augenblick ist der General mit einer erheblich größeren Krise beschäftigt: Das Plüschkrokodil ist verschwunden, und wenn es nicht innerhalb der nächsten dreieinhalb Minuten wieder auftaucht, droht die Welt unterzugehen. Er weiß nicht, wo ihm der Kopf steht. Die Befehlskette funktioniert nicht mehr. Der Herrscher des Landes jagt gleich drei Säuglingen hinterher, die über das Muster seines seidenen Teppichs krabbeln. Sein Motto war immer: Je mehr Kinder, desto besser, und deshalb hatte er zur Sicherheit Cynthia, Olivia und Diane gleichzeitig befruchtet. Aber damals hatte er ja nicht ahnen können, wohin das führen würde. Dass er die Saat seiner Lenden nun plötzlich selbst an der Backe beziehungsweise in den Armen hatte. Von wo aus sie immer wieder entflutschte, es war schlicht unmöglich, drei Säuglinge gleichzeitig zu halten. Er brüllt, sein Berater möge erscheinen, aber plötzlich. Aber Brüllen ist keine gute Idee, weil die Babys direkt einstimmen. Der Lärm übertrifft jeden Tornado, und außerdem ist der Berater damit beschäftigt, seine eigene Zweijährige einzufangen, die gerade im Begriff ist, mit einer Handgranate Fußball zu spielen. Überall sind plötzlich Kinder, winzige, quirlige, sehr lebendige Kinder, dass man keine Hand mehr frei hat, um ein Maschinengewehr zu bedienen. Und niemand, wirklich niemand will seinen Platz im Panzer mit einem Säugling in voller Windel teilen.
Es ist ein Albtraum.
An Krieg ist wirklich nicht mehr zu denken.
Frohe Weihnachten.
aus: Der Stolperengel. 24 funkelnagelneue Weihnachtsgeschichten, Herder Verlag
mit llustrationen von Nina Hammerle
Kürbis statt Kapitulieren

Rilke sagt, der Sommer war groß, die Kirchen feiern Erntedank und durch meine Timeline rollen Kürbisrezepte. Der Herbst ist die sentimentalste der Jahreszeiten. Über allem liegt ein Goldfilter. Was jetzt nicht getan ist, wird nicht mehr getan. An den Türen hängen Kränze aus Hagebutten (fünf Euro der Zweig), die Welt soll bitte draußen bleiben. Altäre werden mit Möhren und Pastinaken und Ährenbündeln geschmückt, dabei greifen die meisten doch lieber zur toskanischen Gemüsepfanne aus dem Tiefkühlregal. „Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land“, singen ein paar Textsichere und denken dabei an die Tüte mit den Kressesamen, die immer noch im Schrank liegt.
Alles, was ich geerntet habe, sind zwei Kastanien.
Sie haben es irgendwie in meine Jackentasche geschafft, man kann sie weder essen noch konservieren, in drei Wochen werden sie schrumpelig sein, aber jetzt fühlen sie sich gut an. Jesus hat sich auf den Altar gesetzt und pult die Körner aus den Ähren. Ich sage, er solle das lassen, das sei Deko. Aber von Deko hält Jesus nichts und ernten ist sowieso nicht seine Sache, er sät lieber. Selbst jetzt im Herbst, wo eigentlich alles gelaufen ist. Mit vollen Händen wirft er seine Saat unter die Leute, und wenn die Hälfte seiner Worte unter die Dornen fällt und im braunen Morast erstickt, entmutigt ihn das nicht. Er sagt Worte wie Frieden und Liebe. Das ist auch ein bisschen retro, jetzt, wo man wieder sagen darf, dass die Ausländer raus müssen und die Grünen weg, weil man dann erstmal einen Schuldigen hat. Damit kennt sich Jesus gut aus. Hauptsache, man nagelt wen ans Kreuz, das ändert nichts an den eigentlichen Problemen, aber es lenkt ab. Ich frage, ob ihn das nicht frustriert. Immer das gleiche, die Menschen lernen nichts, auch in 2000 Jahren nicht.
Da möchte man doch den Kopf in den Acker stecken.
Aber Jesus ist selber abgelenkt, er scrollt durch Kürbisrezepte. „Guck mal“, sagt er, „das kenne ich noch nicht. Das probiere ich heute Abend aus. Kommst du? Bring mit, wen du willst, der Topf ist groß.“ Ich will einwenden, dass Suppe auch keine Lösung ist. Aber dann halte ich mich an meiner Kastanie fest und nicke tapfer, weil Jesus schon immer mehr fürs Tun als fürs Lamentieren war. Kürbis statt Kapitulieren.
Sandkornsegen

Gott sitzt im Sand
und segnet dich
Sandkorn für Sandkorn
rieselt in die Lücken
die du nicht zu füllen brauchst
Geh, sagt Gott. Ich bleibe
Gott sitzt im Sand
und segnet dich
Sandkorn für Sandkorn
Segen
aus: Wohnzimmerkirche im September
Streik

Als die Freiheit streikte, stand sie mit einem selbstgebastelten Schild in der Fußgängerzone. Sie stand ganz allein da und tat mir leid, weil niemand sie beachtete. Irgendwer protestiert ja dauernd wegen irgendwas; fürs Klima, gegen den Krieg – in der Ukraine oder im Gaza, von Afrika rede ich erst gar nicht, ich bin schon froh, wenn es am Küchentisch friedlich ist. Damit habe ich genug zu tun.
Ich sehe, wie die Freiheit tapfer ihr Schild in die Höhe hält: „Unterstützung gesucht!“, lese ich, und spüre, wie Ärger in mir hochkriecht. Was sollen denn andere sagen! Die Freiheit kann doch machen, was sie will, während unsereins um acht im Büro sein muss und die Waschmaschine piept und die Kinder wollen Schokopops und anschließend muss man sie zum Zahnarzt schleppen ob sie wollen oder nicht. Man muss die Steuererklärung machen, sich für eine Zahnzusatzversicherung entscheiden, muss aufgeklärt sein über die Gefahren der KI, muss Abkürzungen kennen, um mitreden zu können, muss Katzenbilder in der Familiengruppe posten – was denn noch alles? Ich steigere mich da so richtig rein, plötzlich tut mir die Freiheit gar nicht mehr leid, im Gegenteil, ich werde immer wütender, weil die Freiheit sowas Anklagendes hat. Als seien wir Schuld an ihrer Misere. Dabei ist sie es doch, die dauernd abwesend ist. Wieso hat sie überhaupt Zeit, da zu stehen, gibt es denn nichts Wichtigeres zu tun? Daran sieht man doch, wie überflüssig sie eigentlich ist. „Eine wie dich muss man sich erstmal leisten können“, rufe ich und erschrecke über die Worte, die da aus meinem Mund kommen. Die Freiheit lächelt müde. „Mich gibt es umsonst“, sagt sie. „Du musst nur aufpassen, dass du mich nicht verlierst.“
Schwimmflügel

„Wir müssen reden“, sag ich und Gott guckt, als hätte sie gerade einen Rollmops verschluckt. Oder er, ich komme da immer noch durcheinander, es verwirrt mich, dass Gott so uneindeutig ist.
„Reden“, sagt Gott, „immer willst du reden.“ Dabei bläst sie ein paar Schwimmflügel auf. Ich lasse mich nicht beirren: „Das Klima, die Rechten, die allgemeine Unzufriedenheit und dann noch die Deutsche Bahn – das geht doch so nicht weiter. Du musst was tun!“
„Ich tue was“, sagt Gott und reicht mir die Schwimmflügel. Sie sind orange, neonorange.
„Was soll ich damit?“
„Die helfen dir, nicht unterzugehen.“
„Ich kann schwimmen.“
„Ich weiß“, nickt Gott und setzt eine Taucherbrille auf. „Aber damit kannst du dich auch mal treiben lassen.“ Dann taucht sie ab.
„Das ist alles, was du für mich tun kannst?“, rufe ich ihr hinterher. Im selben Moment kreischt eine Möwe, die Luft riecht nach Nivea, und das Wasser glitzert mir entgegen.
Kleine Pfingstgeschichte

Vor 2000 Jahren, es ist Frühling, sitzen fünf Frauen und zwölf Männer unter einem Dach. Vielleicht waren es auch mehr. Fenster und Köpfe sind vernagelt, ihr Raum ist eng. Es ist gerade mal 50 Tage her, da wurde ihr Freund umgebracht. Wurde gefoltert und an ein Kreuz genagelt, wurde hängen gelassen, bis er tot war. Und allen, die zu ihm gehörten, wurde gedroht: Euch kriegen wir auch noch. Seitdem ist nichts mehr sicher. Zwar treffen sie sich auch nach Jesu Tod regelmäßig. Aber die Angst sitzt immer dabei. Obwohl er tausendmal gesagt hat: „Fürchtet euch nicht!“
Anfangs, in den ersten Wochen, war alles noch so lebendig. Da war er noch da. Beim Essen, wenn sie zusammensaßen, unterwegs. Sie spürten noch seine Kraft. Sie hörten noch seine Stimme: „Der Himmel ist ganz nah. Er hat längst begonnen.“ Mit der Zeit wurden die Worte leiser, bis sie schließlich ganz verstummten.
Seit zweitausend Jahren warten fünf Frauen und zwölf Männer auf ein Wunder. Vielleicht sind es auch mehr. Und plötzlich, an einem ganz normalen Tag im Frühling, passiert etwas. Es beginnt mit einem Kribbeln. Im Bauch oder in der Herzgegend. Aus dem Kribbeln wird ein Brennen, es entfacht sie zu neuem Leben. Plötzlich erinnern sie sich wieder: „Wo sind eigentlich unsere Träume hin? Wie konnten wir die vergessen?“
Sie öffnen die Tür und stürmen ins Freie. Viel zu lang haben sie hinter den Mauern gehockt. Viel zu lang haben sie geglaubt, jedes Wort aus seinem Mund konservieren zu müssen, damit bloß nichts verloren geht.
Plötzlich ist die alte Begeisterung wieder da, plötzlich haben sie wieder Rückenwind: Eine stimmt ein Lied an. Einer dichtet eine Ode an die Freiheit. Gemeinsam rufen sie: „Wir sind mehr!“ Alle reden durcheinander, das ist kein Chor, das ist Chaos. Und Gott schwebt über dem Chaos und ist froh, dass wieder Leben in ihnen ist.
Auf der Straße bringen sie den Alltag ins Stolpern. „Was sind das für Leute?“, fragt eine Passantin.
„Ist denn schon Feierabend?“, wundert sich ein Kommunalbeamter.
Und ein Priester empört sich: „Die sind doch betrunken!“ Hunde bellen und ein Huhn entwischt dem Beil des Schlachters.
„Hier kommt die Zukunft“, rufen sie. „Und sie beginnt jetzt! Die Alten werden ihre Träume erzählen. Die Jungen werden ihre Utopien leben. Zusammen werden wir Prophetinnen und Propheten sein!“
Ein Kreis aus Menschen bildet sich um sie. „Sind das nicht die, deren Anführer getötet wurde? Wie kommt es, dass sie lachen?“
Erklären können sie das nicht. Trotzdem versuchen sie es. Sie stammeln und verheddern sich. Aber ihre Worte erzeugen ein Echo.
Wir können es hören: Jetzt.
So oder so ähnlich erzählt es die Bibel in der Apostelgeschichte
aus: Fernseh-Wohnzimmerkirche zu Pfingsten in der ARD. Kann man hier nachschauen:
https://www.ardmediathek.de/video/gottesdienst/pfingstgottesdienst-ueber-den-ur-schall/das-erste/
Sonntagsgebet

Du im Himmel,
wir wollen keinen Krieg
statt Panzer wollen wir Pfirsichblüten
wir wollen Geld ausgeben für Kinder
Armut ist ein tristes Kleid
Wir wollen kein Hochwasser
und keine Erdbeeren im März
die Erde liebhaben wollen wir
Wir wollen keine Schmerzen
aber wenn sie da sind
wollen wir Hände die uns halten
und niemand fällt heraus
Wir wollen gerechte Renten
und geteilte Träume
Wir wollen Leben
das nach Zukunft schmeckt
Leinenweiß

Ich nehme die Schuld
und lege sie in ein Bett
aus gestärkten Leinen.
Schlaf, sage ich,
die Nacht singt dir ihr Wiegenlied.
Ich bleibe drei Atemzüge,
dann gehe ich durch die Schwärze davon.
Der Mond geht unter.
Die Luft wird leicht.
Am Horizont das Licht.
Die Schuld träumt
einen zarten Traum.
Am Morgen ist sie verwandelt,
weiß der Himmel wie.
Non. Nein. Nö.

Heute Morgen höre ich eine Andacht anlässlich des „Frauenkampftages“, so nennt die Pastorin ihn und beginnt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Nö. Nö, ich möchte keinen Gott mehr in einseitig patriarchaler Sprache feiern. Auch nicht aus Traditionsgründen. Es gab auch mal die Tradition, Hexen zu verbrennen, Kinder zu schlagen und Hunde in Deiche einzubuddeln, um den Geist der Sturmflut zu besänftigen. Man muss nicht jede Tradition von Ewigkeit zu Ewigkeit schleppen.
Frauen sind ja nicht diese seltene Spezies, sondern mehr als die Hälfte der Menschheit. Angeblich hat Gott diese Menschheit nach dem eigenen Ebenbild geschaffen. Also wohnen in Gott alle Facetten des Menschseins. Warum beschränken die meisten Kirchenmenschen Gott auch im Jahr 2024 auf eine einzige, nämlich den Vater?
Nö, ich möchte Weiblichkeit auch nicht mitgemeint denken. Wer einen so kleinen Wortschatz hat, wer keine weiteren Bilder von Gott findet, ist kein Traditionalist, keine Traditionalistin, sondern phantasielos oder denkfaul. Was für ein armes Bild, wenn Gott eine so übergroße Männlichkeit bräuchte, um zu existieren. Sprache schafft Wirklichkeit: Wenn Gott eine Weltgeschichte lang männlich gepredigt wird, werden Männer vergöttert. So geschehen in den Zeiten des Patriachats. Männer lernen von Kindesbeinen, breitbeinig zu stehen. Frauen müssen das üben.
Ich stehe hier nicht im Namen eines Vaters, Sohnes und wenn es gut läuft einer weiblich angehauchten Geistkraft. Ich stehe hier im Namen einer Kraft, die uns Denken, Fühlen, Entscheiden lässt.
Nö, ich will den Vater, Herrn, Herrscher, König, den Allmächtigen nicht verbieten. Wer Gott weiterhin einseitig männlich feiern will, möge das tun. Ich gehe einfach auf eine andere Party. Adios.
Wohnzimmerkirche "Non. Nein. Nö" vom 8. März
Und. ein Hoch auf die Gleichzeitigkeit

Ich stelle mir vor: ein Tag, an dem alle anziehen, wovon sie insgeheim träumen. Wie Karneval, nur in echt. Sibylle zum Beispiel trägt ein Kleid aus 943 Federn, die hat sie alle eigenhändig angenäht. Weil sie sich mal wie ein Vogel fühlen will. Paul trägt Pailletten zum Blaumann. Igor trägt wie immer Jeans und Wollpullover, weil er sich darin am allerwohlsten fühlt und zutiefst Igor ist. Frau Piepental hat ihren Petticoat rausgeholt und niemand sagt: Na wissen Sie, in Ihrem Alter…
Es gibt Könige und Draufgängerinnen, es gibt Nietenhosen und Zweireiher, Kopftücher und Knickerbocker, es gibt grau und rosa. Es gibt Kippa und Krawatte, und Josef steht in seinem Prinzessinnenkleid dazwischen und fällt überhaupt nicht auf, weil er dazugehört. So wie alle dazugehören. Und nein, es geht nicht darum, wer am grellsten leuchtet. Es geht einfach nur ums Sein. Und niemand haut das eigene Sein anderen um die Ohren.
Und Gott schaut sich das an und findet es gut. Das glaube ich zumindest, auch wenn ich es natürlich nicht weiß. Kein Mensch weiß, was Gott denkt, sagt, will, tut. Ich stelle mir vor, wie Gott zwischen all den bunten Menschen steht und sich verbeugt. Das irritiert, also passt es zu Gott. Gott irritiert oft.
Ein paar Leute machen es nach. Sibylle verbeugt sich vor dem Knickerbockerträger, Igor verbeugt sich vor einem kleinen Mädchen mit Hut. Ein Punk verbeugt sich vor Oma Grete, eine Polizistin verbeugt sich vor einer Linksalternativen und umgekehrt, ein Golden Retriever verbeugt sich vor einer misstrauischen Katze.
Einfach aus Respekt vor seinem oder ihrem Sein. Auch vor ihrem Anders-Sein. Eine Verbeugung ist eine kurze Geste. Wer in ihr verharrt, buckelt. Darum geht es nicht. Sondern darum, einander groß zu machen. Wechselseitig und abwechselnd. Anzuerkennen: Du bist anders. Ich bin anders. Und wir gehören als Menschen trotzdem zusammen. Wir werden einen Weg finden, nebeneinander zu leben, ohne einander in den Schatten zu stellen.
Januar

Im goldenen Licht eines Januarnachmittags
bin ich über den See geglitten
und habe Spuren gesehen
von Elch und Hase und Fuchs
und von etwas tapsig Kleinem.
Aber Elch und Hase und Fuchs
habe ich nicht gesehen,
auch keinen Taps gehört.
Trotzdem sind sie da.
Was könnte alles noch da sein,
das ich nicht sehe?
Was könnte alles drin sein
in diesem weißen Jahr?
Auf Anfang

Stell dir vor:
In dieser Nacht setzt dir jemand eine Krone auf.
Weil du es bist.
Weil du immer noch suchst.
Nimm das Wertvollste, das du hast.
Nenn es Sehnsucht. Oder Liebeshunger. Oder Wissensdurst.
Du bist nicht fertig.
Stell dir vor:
In dieser Nacht setzt dir jemand eine Krone auf.
Weil du es bist.
Du wirst sieben Zentimeter größer.
Du wächst in dich hinein
und über dich hinaus.
Dein Glanz legt sich auf müde Gesichter im Bus.
Erhellt die Fischfrau auf dem Markt.
Ist ein Lichtblick für irgendwen.
Du berührst.
Stell dir vor:
In dieser Nacht setzt dir jemand eine Krone auf.
Sagt: Greif nach einem Strohhalm
und geh los.
Da draußen wird ein Anfang geboren.
Du wirst ihn finden
zwischen den Räumen.
Du wirst ihn finden
stolpernd unter einem Stein.
Du wirst ihn finden
in einem sternklaren Augenblick.
Da draußen wird ein Anfang geboren.
Nimm ihn zu Herzen. Füttere ihn. Bring ihn zur Welt.
Wohnzimerkirche "Auf Anfang". 15. Dezember 2023
Möglichkeitsräume

Der Tag ist noch nicht zu Ende. Ein paar Stunden haben wir noch und was könnte in diesen Stunden alles geschehen! Und damit meine ich nicht die fürchterlichen Dinge. Ich meine keine weiteren Katastrophen, keine neuen Tragödien. Ebenso wäre es doch möglich, dass genau jetzt irgendwo auf der Welt etwas Wunderbares passiert. Und wenn nicht jetzt, dann vielleicht in einer halben Stunde. Wir brauchen Möglichkeitsräume. Das sind Räume, in denen alles drin ist. Innere Räume, in die man hineingehen kann und sich vorstellt, was noch nicht ist, aber sein könnte: Zum Beispiel könnte heute Abend Wladimirs Herz warm und laut sein, und er stoppt einen Krieg. Der Papst könnte seine Verlobung mit Alfonso bekannt geben und die ganze Kurie feiert Junggesellenabschied. In seinem unergründlichen Ratschluss könnte Gott alle SUVs in Lastenfahrräder verwandeln. Eine rechtsextreme Partei könnte einen Ausflug ins Bällebad machen und nie wieder auftauchen. Irgendwo auf der Welt könnte sich ein Wunsch erfüllen, könnte jemand sagen: Ich habe mich geirrt, könnte ein Topf Basilikum überleben. Irgendwo auf der Welt könnte Frieden beginnen, in einem Hinterzimmer, bei einer Verhandlung, an einem Küchentisch. Es wäre möglich. Vielleicht genau jetzt.
Gleichzeitig

Alles hat seine Zeit
Nachrichten hören
Playlist auf laut stellen
Widersprechen
lernen, was ich nicht weiß
Mitgefühl zeigen
den Kopf in ein Kaninchenfell vergraben
#erntedank

Jesus streift durch die Felder und lässt seine Hand durch die Ähren gleiten. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt und wonach es riecht: nach Staub und frischem Brot und nach zuende gehendem Sommer. Die Sonne steht tief, es ist Nachmittag und das Licht färbt seine Haut golden. Ich frage mich, ob ich genauso glänze wie er. Manchmal rauft er eine Ähre und pult die Körner raus. „Karge Ernte“, sage ich und wundere mich, denn es ist nicht sein Feld und nicht er war es, der gesät hat. Er schüttelte den Kopf. „Ich ernte nicht“, sagt er, während er auf einem Korn knabbert. „Ich habe keine Scheune, nicht mal einen Küchenschrank, in dem ich das Mehl lagern könnte. Ich habe nichts.“ Ich will widersprechen, will sagen: „Du hast eine Menge: Freunde und Unterstützerinnen, du hast Mut und Vertrauen, mehr als jeder Küchenschrank fassen könnte.“ Aber bevor ich den Mund öffne, schüttelt er den Kopf. „Ich möchte nichts haben“, sagt er leise und bestimmt. „Ich möchte leben und lieben, nehmen und geben, ich möchte mich verschwenden. Ich möchte sähen, während ich weitergehe, unterwegs möchte ich einer Blume Wasser geben und einem hungrigen Huhn ein paar Körner hinwerfen. Ich möchte teilen, was ich nicht besitze. Ich möchte Wörter sammeln und sie mir eine Zeitlang auf die Zunge legen, bevor ich sie an anderer Stelle wieder fallenlasse. Ich möchte mir etwas zu Herzen nehmen, ohne es festzuhalten.“ Seine Sätze berühren mich, sie sind so schlicht, ich will sie unbedingt behalten, da vibriert mein Handy und lenkt mich kurz ab. Eine Push-Up-Nachricht meldet fallende Aktienkurse. Ständig bekomme ich solche wichtigen Mitteilungen, ich weiß nicht, wie man die ausschaltet. Ich müsste es recherchieren, genau wie ich mehr über Aktien wissen müsste, wegen der Rente und auch, um mitreden zu können. Als ich das Handy wieder wegstecke, ist die Sonne hinterm Horizont verschwunden. Und auch der Glanz. Ich merke, dass ich Hunger habe. Jesus kramt in seinen Taschen und fischt eine halbe Tüte Salzlakritz heraus. Ich stecke mir zwei in den Mund, obwohl ich kein Lakritz mag. Aber in regelmäßigen Abständen probiere ich sie wieder, Vorlieben ändern sich. Früher konnte ich nicht genug von Bifi bekommen, das ist so eine Minisalami in Plastikhaut. Heute verursacht mir allein schon der Geruch Übelkeit. „Gut“, sagt Jesus, „dass du keinen Vorrat angelegt hast.“
Poolparty

Im Süden ist es heiß und trocken, die einen kleben auf der Straße fest, die anderen preisen, dass es mal wieder richtig Sommer ist. Ein Sommer, in dem man den Pool im Garten füllen kann und Schirmchen ins Cocktailglas steckt. Was man nicht ändern kann, muss man feiern. „Ihr könnt was ändern“, ruft Jesus, aber die Musik spielt anderswo und Jesus ist sowieso ein Spielverderber. Immer wenn man gerade Spaß hat, erinnert er an die anderen, die keinen Spaß oder keinen Pool haben, erinnert er an die, für die Wasser kein Freizeitvergnügen, sondern Überleben bedeutet. Alle gähnen, jetzt kommt die Predigt. „Lass es halt regnen“, ruft einer und der Rest johlt, „du bist doch Profi in Sachen Wunder!“ Eh klar, dass niemand an diese Geschichten mehr glaubt. Wunder sind keine sichere Bank. Das ist unbequem, weil man bis zum nächsten Wunder doch wieder selbst ran muss, um die Welt zu retten. Dabei ist es schon anstrengend genug, das Gefühl der eigenen Ohnmacht nicht an die Oberfläche zu lassen. Ohnmacht ist ein Eisberg, was man sieht, ist nur die Spitze, aber das Eis schmilzt ja sowieso gerade, was soll’s also – lasst uns feiern und den Sommer genießen. Und überhaupt: war da nicht was, verwandelt Jesus selbst nicht Wasser in Wein, warum dann nicht gleich in einen Wildberry Lillet?
Aber Jesus hat sich aus dem Staub gemacht, wahrscheinlich reicht er das Wasser gerade den Klimakleber*innen, auf dem Asphalt ist es heiß. Die nerven, Jesus nervt, dass entweder Waldbrandgefahr oder Überschwemmung ist, nervt auch.
Ich verlasse die Party und beschließe, ins Freibad zu gehen, da dürfen wenigstens alle rein. Das Wasser ist kalt, kälter als gedacht. Ich sitze am Rand und stippe die Zehen ins Becken, da sehe ich Jesus übers Wasser kommen. Er hält ein selbstgemaltes Plakat in der Hand: „Heute schon an die Party von Morgen denken: Save the planet.“ Die Leute schwimmen einen großen Bogen um ihn, als sei er ein Gespenst, ganz allein steht er in der Mitte der Wasserfläche. Fast könnte er einem leidtun. „Komm“, ruft er. Ich hätte mich gern weggeduckt, doch er hat gesehen, dass ich ihn sehe. „Ich kann nicht“, sage ich. „Dann schwimm halt. Oder willst du wirklich, dass die Welt baden geht?“ Natürlich nicht. Also stehe ich auf, nehme Anlauf und springe rein ins kalte Wasser. Direkt vom Beckenrand. Obwohl das doch verboten ist.
Wie ich mal fast (aber nur fast) reich geworden wäre
„Guten Tag“, sagte der Herr im Blockstreifenanzug, „darf ich mich vorstellen? Wir kennen uns noch nicht. Ich bin ab heute ihr persönlicher Engel, Abteilung strategische Lebensplanung und Anlageberatung. Ich bin ganz für Sie da.“
„Wir siezen uns?“
„Das gehört zu unserer neuen Strategie. Unsere Zielgruppenanalyse hat ergeben, dass Engel nicht mehr ernst genommen werden. Da möchten wir gegensteuern.“
„Aha.“
„Ich habe eine Weiterbildung zum Vermögensberater abgeschlossen.“
„Ach. Von welcher Art Vermögen reden wir?“
„Ich bin spezialisiert auf Vertrauensvorschüsse, Glücksdepots und japanische Aktienfons.“
„Interessant…“
„Nicht? Wie reich möchten Sie denn werden?“
„Das kann ich mir aussuchen?“
„Als Engel performen wir mit Skills, die über die eines gewöhnlichen Bankberaters hinausgehen.“
„Erstaunlich.“
„Sie sagen es. Wenn das nur mehr so sehen würden.“
„Was unterscheidet Ihr Institut denn von gewöhnlichen Banken?“
„Im Grunde nichts mehr. Wir betreiben natürlich Traditionspflege. Unsere Geschäftspapiere ziert das Wasserzeichen „Glaube, Liebe. Hoffnung“. Dezent, aber wirkungsvoll. Unsere Marketingabteilung nutzt eingeführte weiche Bilder wie Himmel, Regenbogen, etcetera. Und dann haben wir natürlich starke Identifikationsfiguren…“
„Sie meinen Jesus?“
„Zum Beispiel.“
„War der nicht gegen Reichtum?“
„Denkt man immer, aber auch Jesus verfügte über ein beträchtliches Vermögen, verteilt auf diverse römische Banken.“
„Sie scherzen.“
„Mitnichten. Denken Sie an den Schatz im Acker. Ein älterer Kollege von mir war sein persönlicher Anlageberater.“
„Ich glaube, Sie erfinden das gerade. Ich habe noch nie von Engeln wie Ihnen gehört. Eigentlich will ich auch gar nicht, dass es solche Engel gibt.“
Die Blockstreifen wellen sich, und mein Gegenüber löst sich in Spielzeuggeld auf, das der Wind in alle vier Himmelsrichtungen verteilt, bis die Luft wieder rein ist.
Tja.
Wieder nix.
Laufende Liste

Ich mag Freiheit. Ich mag, dass auf der Straße ein Klavier steht.
Ich mag keine Musik, die mich nervt. Jazz zum Beispiel.
Ich mag keine Pauschalisierungen. Ich mag Menschen,
die eine Haltung haben und sie begründen können.
Ich mag Menschen, die gelenkig genug sind, ihre Haltung zu ändern.
Ich mag Yoga. Ich mag Selbstironie.Ich mag es nicht,
wenn zu viel erwartbar ist. Ich mag Listen.
Ich mag kleine Häkchen, die mir zeigen, dass ich schon viel geschafft habe.
Ich mag es nicht, zu prokrastinieren. Manchmal tue ich es trotzdem,
weil ich das Kribbeln mag, wenn es eng wird. Ich mag Kirchentagsschals.
Ich werde nie einen tragen. Ich mag Widersprüche.
Ich mag Eis im Allgemeinen. Außer Nuss. Und Banane. Ich mag das Gefühl von Danach
und das Gefühl von Davor. Gerade bin ich genau dazwischen.
(to be continued)
Konfetti für alle!

Als Gott die Welt auf den Kopf stellt, öffnet sie den Himmel und ruft: "Hereinspaziert, hereinspaziert!"
Als erstes kommen die Zweifler um die Ecke und können es nicht glauben: "Echt jetzt, Himmel für alle, einfach so? Gibt’s denn sowas?"
Und Gott sagt: "Wenn ihr dran glaubt, dann gibt es das."
Und sie wirft 5 Hände Regenbogenkonfetti und verschenkt ein Lächeln, das einfach bezaubernd ist.
"He", rufen da welche. "So geht das aber nicht. Erst sind wir dran. Schließlich waren wir jeden Sonntag in der Kirche. Morgens um 10. Ohne Frühstück! Wenn die da 5 Hände Konfetti kriegen, verdienen wir 10! Und doppelten Zauber, mindestens."
Gott ist ein bisschen ratlos, weil Zauber plus Zauber ist Zauber, und Himmel plus Himmel ist immernoch Himmel.
"Moooooment", rufen da noch andere, "nicht so schnell! Wir waren schließlich von Anfang an dabei. Wir beten seit 27 eineinhalb Jahren morgens, abends und mittwochs sogar mittags. Wir haben die Bibel einmal von vorn und einmal von hinten gelesen. Und wir waren auf jedem Kirchentag. Wenn jemand als erstes in den Himmel kommt, dann jawohl wir! Die anderen, die müssen erstmal nachsitzen: 100 Vater Unser und einmal Pilgern auf dem Jakobsweg!"
Es wird sehr laut am Himmelstor, es donnern die Stimmen, es fliegen die Funken, so dass selbst die Engel sich die Ohren zuhalten und sich wundern. Der Himmel ist doch so groß, so unendlich groß.
"Beruhigt euch", ruft Gott, "es gibt Platz genug für alle! Für die Zweiflerinnen und für die Frommen, und ihre 1000 Gebete passen auch mit rein. Für die mit dem klitzekleinen Glauben und selbst für die Schurken gibt es irgendwo ein Plätzchen (aber nicht ganz vorn, das dann doch nicht)."
"Das ist ungerecht", schreien die Frommen. "Wozu haben wir denn unser ganzes Leben gebetet?"
"Wozu habt ihr geküsst?
Wozu habt ihr Regenbögen bewundert?
Wozu eure Nasen in den Wind gehalten?
Wozu habt ihr in Sommernächten ins Feuer geschaut?
Wozu die Katze des Nachbarn gekrault?
Weil es schön ist. Einfach, weil es schön ist.
Hereinspaziert!
Die Letzten sollen auch mal die ersten sein, die Langsamen nach vorn, und ein Mohnblütenteppich für die Verzagten.
Wer nichts zu bieten hat, braucht alles das doppelt so sehr. Kein Neid, hereinspaziert, der Himmel ist groß, Konfetti für alle!"
Gott mit Sternchen. Wie wollen wir reden?

Als Gott mir vorgestellt wurde, war ich 14. Vorher hatte ich schon manchmal von ihm gehört – und ja, ich sage „ihm“, denn Gott war ein Herr. Ein bisschen aus der Zeit gefallen, so wie Herr Busche von nebenan, der sein Geld als Klavierlehrer verdiente und aus dessen Wohnung manchmal schwer zugängliche Musik kam. Herr Busche trug immer einen Hut und sprach nicht viel. Ich grüßte ihn schüchtern und irgendwie auch ehrfurchtsvoll, denn er war ganz anders als mein Vater, der am liebsten Blasmusik hörte und auch gegen Schunkeln nichts einzuwenden hatte.
Gott schunkelte nicht. Er hatte genug damit zu tun, die Welt in Gut und Böse zu teilen und vorwurfsvoll zu gucken wegen der Sache mit seinem Sohn, auf den wir nicht genug aufgepasst hatten.
Das war sehr anstrengend, und als ich erwachsen genug war, sagte ich, ich bräuchte mal ein bisschen Abstand und das Überraschende war: Gott nickte und sagte „ich auch“. Und dann löste Gott sich auf und tauchte später an ganz anderer Stelle wieder auf, und es begann eine neue Geschichte.
Doch bis dahin sollte es dauern. Zunächst lernte ich, mitgemeint zu sein. Wenn der Pastor „Liebe Brüder“ sagte. Pastorinnen gab es nicht, jedenfalls nicht in der evangelischen Landeskirche da, wo ich aufwuchs. Frauen und Männer seien gleichwertig aber nicht gleichartig, hieß es. Enten bauten ja auch keine Biberdämme und Frauen gehören nicht auf die Kanzel. Dieser Satz brannte sich mir ein, ich stand ihm mit meinen 15 oder 16 Jahren ohnmächtig gegenüber. Als würde mich ein Biologielehrer einer bedrohten Art zuordnen, die es zu erhalten galt. Eine Art, die er und seine Kollegen eingehend studiert hatten. Welche Fähigkeiten sie hat, in welchem Habitat sie sich wohlfühlt, das definierten Männer...
Und auch Frau Engelking, die die Kinderkirche leitete und uns Helferinnen beibrachte, wie man Kindern von Gott erzählt: Als Vater, der alle liebhat, aber auch streng ist. Wenn man nicht tut, was er will, wird er böse. Siehe Sintflut. Den Kindergottesdienst durften Frauen leiten, im Gegensatz zu richtigen Gottesdiensten. Weil Frauen einen natürlichen Draht zu Kindern haben, artgerecht sozusagen.
Das alles fand nicht in den Fünfzigern statt, sondern in den 1980er-Jahren. Wo die Infohefte des Arbeitsberaters, der in unsere Schule kam, bereits genderten. Es gab Informatiker und Informatikerinnen, Köchinnen und Köche, Theaterwissenschaftlerinnen und Theaterwissenschaftler. Theoretisch konnte ich alles werden. Nur nicht Pastorin.
Wollte ich auch nicht. Aber dass Gott das angeblich aus Prinzip auch nicht wollte – das nahm ich ihm krumm.
Es ist schwierig, mit Gott zu diskutieren. Mit Menschen geht das theoretisch besser. Allerdings begegne ich immer wieder Menschen, die sehr genau darüber Bescheid wissen, wie Gott denkt und was Gott will. Das wundert mich. Woher wissen sie das?Über 2000 Jahre wurde die Geschichte des christlichen Gottes überwiegend von Männern erzählt. Sie waren lauter. In einer patriarchalen Gesellschaft kein Wunder. Dass es dabei viel um Macht und nicht bloß um Erleuchtung ging, ist bekannt.
Ein schönes Beispiel ist Junia. In der Bibel schreibt Paulus über sie und einen gewissen Andronikus: „Sie sind herausragend unter den Aposteln und haben sich schon vor mir zu Christus bekannt.“
Eine Frau als Apostel? Auch Johannes Chrysostomus, im vierten Jahrhundert Bischof von Konstantinopel, hebt das besonders hervor: „Ein Apostel zu sein ist etwas Großes. Aber berühmt unter den Aposteln – bedenke, welch großes Lob das ist. Wie groß muss die Weisheit dieser Frau gewesen sein.“
Bis heute lehnt die katholische Kirche das Priestertum von Frauen ab, unter anderem mit der Begründung, es habe keine Apostelinnen gegeben. Und tatsächlich verschwand Junia im Lauf der Geschichte. Oder sagen wir, sie wechselte das Geschlecht. Allerdings nicht freiwillig. Man hängte einfach ein „S“ an ihren Namen. Aus Junia wurde Junias. Sie wurde zum Mann. Zum ersten Mal taucht Junias nachweislich im 13. Jahrhundert auf – bei Ägidius von Rom, einem Schüler des Kirchenlehrers Thomas von Aquin. Nicht gerade als Feminist bekannt. Martin Luther übernahm das. Dabei gibt es den Name Junias in der antiken Literatur sonst nicht, während Junia ein verbreiteter Frauenname war.
Und Junia ist kein Einzelfall. Auch Maria von Magdala wurde über ein Jahrtausend Apostelin unter den Aposteln genannt. Sie war die erste, die dem auferstandenen Jesus begegnete. Und sie wurde verehrt deswegen. Spätantike Texte belegen das.
Im Mittelalter wurde aus ihr eine Sünderin, eine Prostituierte, bis ihr Ruf nachhaltig beschädigt war.
Es ist gar nicht so, dass es im biblisch-frühchristlichen Universum keine Frauen gab. Sie wurden nur mundtot gemacht. Blöd, wenn frau nach Identifikationsfiguren sucht.
Seit 2016 steht in der Einheitsübersetzung übrigens wieder Junia, seit 2017 auch in der Lutherbibel.
Die Bibel erzählt durchaus in verschiedenen Perspektiven von Gott. Überwiegend männlich, weil von Männern geschrieben. Im Buch des Propheten Hosea sagt Gott über sich selbst:
„Ich bin Gott und kein Mensch, ich bin heilig in deiner Mitte .“ Und im 2. Buch Mose antwortet Gott auf die Frage nach dem Namen: „Ich-bin-da.“ Oder einfach „Ich-bin.“ Kein Mann, keine Frau, kein Mensch.
Als ich das zum ersten Mal las, begann eine neue Geschichte.
Eine, die Gott frei lässt. Die Gott nicht unter einen Hut mit Männern steckt. Die Kategorie männlich (genau wie weiblich) beinhaltet so viele Zuschreibungen, die Gott und Menschen festnageln.
Kleiner Exkurs:
Ich bin ein Mensch. Im Körper einer Frau. Ich kann gut zuhören, aber nicht nähen. Ich mache gern Feuer, finde Röcke angenehmer als Hosen und mochte rosa schon, bevor es Prinzessin Lillifee trug. Ich habe keine Kinder geboren und bin glücklich damit. Ich fahre gern Auto, genieße es manchmal, mich anzulehnen und gehe an anderen Tagen vorweg. Ich hasse es, mein Fahrrad zu flicken und freue mich, wenn jemand Spinnen aus dem Weg räumt. Eine Maus würde ich aber jederzeit auf die Hand nehmen. Manchmal bin ich härter als ich will. Ich koche täglich, eine Bratpfanne auf dem Geburtstagstisch wäre für mich keine Beleidigung. Fußballübertragungen langweilen mich, Fashionfragen auch. Ich habe eine Vulva und finde das gut, allerdings habe ich auch keinen Vergleich, wie es mit einem Penis wäre (etwas unpraktischer stelle ich es mir vor).
Was ich damit sagen will: Die Frage, ob ich mich weiblich fühle, spielt für meine Identität keine große Rolle. Ich bin ich. Ich fühle mich gut (jedenfalls im Großen und Ganzen). Und ich möchte in einer Welt leben, in der das jede und jeder von sich sagen kann. In der Menschen dieselben Rechte haben. Einen Rock tragen dürfen und einen Bart. An manchen Tagen zartbesaitet sind, an anderen gestählt. Alle Zeit der Welt mit Kindern verbringen dürfen, ohne sich dafür entschuldigen zu müssen. Oder mit einem Floß den Mississippi queren dürfen oder glücklich hinter Aktenordnern verschwinden. Mit Hüftschwung durch die Straßen gehen oder mit Stiernacken. Und das alles sollte keine Frage des Geschlechts sein, sondern der Sehnsucht: Wer bin ich? Was entspricht mir?
Ich möchte in einer Welt leben, in der es weniger Kategorien gibt und mehr Sein.
Ich bin. Ich bin da.
Gott: ist kein Mensch. Trotzdem brauche ich manchmal Bilder von Gott. Ich brauche Geschichten, die Gott auf die Erde holen. Die davon erzählen, wie andere Gott erleben. Wenn eine Geschichte konkret sein soll, dann kann sie nicht alles offen lassen. Sie malt Bilder in meinem Kopf und in meinem Herz. Ich habe also nichts dagegen, die Geschichte vom Verlorenen Sohn zu hören und kann mich mit ihm identifizieren, obwohl er als Mann beschrieben wird. Allerdings spricht auch nichts dagegen, diese Geschichte als Geschichte einer Tochter zu erzählen. Es handelt sich ja um ein Gleichnis und nicht um eine historische Begebenheit. Es geht nicht um die einzelne Person, nicht um die einzelne Geschichte, sondern um das große Ganze. Und in dem ist es eben so: wenn nichts von Töchtern erzählt wird, dann werden sie auch im tatsächlichen Leben eine untergeordnete Rolle spielen. Sprache bildet Wirklichkeit nicht nur ab – sie schafft auch Wirklichkeit. Das ist ihr Zauber. Und Zauberei kann beides: etwas verschwinden oder etwas erscheinen lassen. Mit den Geschichten, die wir erzählen, entscheiden wir, ob wir eine einfältige oder eine diverse Welt abbilden.
Wenn wir Gott in Geschichten immer wieder darauf reduzieren, Herr oder Vater zu sein, dann machen wir Gott klein. Dann zäunen wir Gott ein. Dann ist das so, als würden wir zu nah an ein unfassbar großes, buntes Mosaik herantreten und nur einen winzigen Ausschnitt betrachten. Und anschließend behaupten, das sei das ganze Bild.
Es ist aber nicht das ganze Bild. Die Erfahrungen, Beschreibungen, Gleichnisse, die Möglichkeiten, von Gott zu erzählen - sie sind so unendlich wie das Universum.
Deshalb lohnt es sich, weiter zu denken und nach den Sternen zu greifen. Auch nach dem Gendersternchen. Nicht um es anderen an den Kopf zu werfen. Nicht als neues Dogma. Sondern um die Sprache zu weiten. Damit wir die Galerie der Bilder Gottes um neue Ansichten erweitern. Damit wir Gott frei lassen, denn Freiheit ist das allererste Gebot: „Ich bin dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. “ Auch aus der Sklaverei einseitiger Bilder und einseitiger Sprache.
Den Herrn mit Hut sehe ich heute manchmal von ferne. Er kommt mir genauso einsam vor, wie damals der alte Herr Busche. Es kann aber auch sein, dass es meine eigene Einsamkeit ist, die ich fühle. Wir haben so wenig gemeinsam. Wie er wohl aussieht, frage ich mich, wenn er den Hut ablegt und die ganze Herrlichkeit dazu?
Auch an Junia und Maria denke ich oft…
Bis ich sie zufällig treffe. In einer Bar, sie sind nicht allein. Sie reden und gestikulieren, zusammen mit vielen anderen feiern sie das Leben. Lachen kommt aus ihrer Ecke, ein freies, kein hämisches Lachen. Ich gehe zu ihnen und spreche sie an, ob sie nicht wütend sind, ob sie nicht kämpfen wollen. „Ach, Wut“, sagen sie. Die haben sie hinter sich. Sie wollen sich nicht mehr abarbeiten an jenen, die Angst haben um Macht und Bedeutung. Sie machen einfach ihr eigenes Ding. Der Herr mit dem Hut sei ohnehin nur eine Projektion, eine Herrschaftsphantasie. Sogar Gott selbst sei seiner müde. Woher sie das wissen, frage ich überrascht. Wissen können sie es natürlich nicht, geben Junia und Maria beide zu. Auch sie nicht, obwohl sie so nah dran waren. „Aber wir können entscheiden, was wir glauben.“
Ich bleibe eine Weile bei ihnen sitzen, es ist so hell und offen in ihrem Kreis, etwas funkelt. Das habe ich lange schon vermisst. Über ihren Köpfen flackern die Lichter in einer Million Farben, und ich wundere mich, mit wem sie alles Umgang pflegen. Selbst Paulus schaut vorbei, Luther und Katharina wagen ein Tänzchen und sind ganz aufgeräumt. „Warum wundert dich das“, rufen sie mir zu. „Alles ändert sich, Sprache sowieso, da sind wir ganz vorn. Wir sind ja nicht mehr im Mittelalter…“ Der Rest geht unter im Stimmengewirr, ich bleibe, ich feiere bis in den Morgen. Später, draußen beim Gehen, fällt mein Blick auf das Leuchtschild über der Tür. „Irgendwas wie Kirche“, steht da. Ich lächele. Wer nennt denn so eine Bar?
Am Sonntagmorgen, Deutschlandfunk. Hier zum Nachhören.
86 400 Sekunden

Stell dir vor: Am Morgen der Welt verschenkt Gott Lebenszeit.
Für jeden Mensch, für jedes Tier, für Olga und Ahab, für die Saurier und die Anemonen, für das Faultier und den Mammutbaum. Lässt regnen so viel Leben, so viel Glück.
Moment, rufen da plötzlich welche. Das ist gar nicht gleichverteilt. Die einen bekommen mehr, die anderen weniger.
Das ist ja total ungerecht!
Und das stimmt. Es ist fürchterlich ungerecht. Die einen haben viel Lebenszeit und die anderen viel zu wenig. Es gibt kein erkennbares System. Als ob sich jemand verrechnet hätte.
Und Gott – schweigt. Wie eine Künstlerin, die ihr Werk nicht erklären will.
Und das Glück? Das ist trotzdem da. Weil Glück nicht rechnet. Glück braucht nicht viel Platz. Glück lässt sich nicht einschüchtern.
Also noch mal von vorn, eine Nummer kleiner:
Am Morgen jedes Tages verschenkt Gott Lebenszeit. Für jeden Mensch, für jedes Tier, für Olga und Ahab, für die Nachkommen der Saurier und für die Anemonen, für das Faultier und den Mammutbaum. Für dich, für mich. Hier, flüstert Gott. Macht was draus.
Die einen machen Picknick, leihen sich ein Pferd, schreiben einen halben Roman, stricken einen krummen Schal, lernen Minigolf, lösen fünf Kreuzworträtsel und eine Gleichung mit vier Unbekannten, teilen einen Schokokuss und schlafen 9,3 Stunden. Sie setzen alles auf diesen Tag.
Andere sind vorsichtiger. Sie halten sich zurück, denn sie wollen die Zeit gut einteilen. Das Spielen verschieben sie auf später, das Picknick verlegen sie an den Küchentisch und schlafen müssen sie ja sowieso. Wenn auch nicht ganz so lang.
Und schließlich gibt es welche, die wollen die Zeit aufsparen. Für etwas Besonders, wer weiß, was noch kommt. Eines Tages, sagen sie. Eines Tages gönne ich mir wirklich was. Die einen sind glücklich. Die anderen sind mittelglücklich. Und die letzten sind gar nicht glücklich.
Und wieder ruft jemand: Das ist ja total ungerecht!
Aber diesmal schüttelt Gott den Kopf: Ihr alle bekommt 24 Stunden mal 60 Minuten mal 60 Sekunden. 86 400 Sekunden Leben. Tag für Tag neu. Und mindestens ein paar davon werden glücken. Macht was draus!
Hütchenspieler

Als Jesus überraschend seine Kirchenmitgliedschaft kündigt, wirft Erna Kozlowski den Staublappen hin. 37 Jahre hat sie den Altar abgestaubt und die Kaugummis der Konfirmanden von den Bänken gepult. Alles für den Herrn Jesus. Aber wenn der feine Herr jetzt zum Dank das Weite sucht, kann sie das auch. Dann macht sie Urlaub auf Mallorca, da träumt sie schon ihren Lebtag von, aber wer nur montags bis samstags Zeit habt, kommt höchstens bis Meschede im Sauerland.
In der Kirche wird es still. Der Organist ist schon vergangenen Herbst an multiplem Organversagen verschieden, und die letzte Konfirmandin meldet sich ab, weil sie jetzt selbst Influencerin ist. Jesus hat das kommen sehen, der Öffentlichkeitsbeauftragte hat ihm dennoch den Insta-Zugang verweigert und stattdessen eine Neuauflage der Bibel in poppigem Pink angeregt. Jesus wirft ein paar Tische um, auch Tastaturen fliegen durch die Luft, eine Mediatorin wird einbestellt, und man gründet nach siebzehn-monatigem Findungsprozess die Stabsstelle Kommunikation, für die sich Jesus aufgrund mangelnder Qualifikation als ungeeignet erweist. Er wird zornig, sehr zornig, und nach dem Zorn kommt die Gleichgültigkeit und was dann kommt, verfolgt niemand mehr.
Aus der Kirche wird ein Zentrum für Zukunftsprozesse. Es erhält einige lobende Erwähnung für energieeffizientes Heizen.
Die Bibel wird auch in Türkis gedruckt.
Erna Kozlowski nimmt eine Stelle als Facility-Managerin in der Filiale einer Imbiss-Kette an. Es heißt, dort träfe sie Jesus öfter umringt von einer beachtlichen Gruppe Neugieriger, er habe erstaunliche Tricks auf Lager, wie ein Hütchenspieler. Aber das kann sich niemand recht vorstellen, so tief würde doch selbst Jesus nicht sinken. Die Pommes aber seien tatsächlich besser als gedacht.
Du im Himmel

Du im Himmel
und unter der Haut
Dein Name ist heilig
deine Wunderwelt komme
Dein Wille geschehe
oben und unten und überall
Gib uns heute, was wir brauchen
Vergib uns
und auch wir vergeben
Sei bei uns, wenn wir uns verlieren
und erlöse uns
Denn du bist Ein und Alles
Kraft und Herrlichkeit und Ewigkeit
Ich suche immer wieder nach Worten, die passen. Zusammen mit Matthias Lemme ist diese Variante des Vater Unsers entstanden.
In der Tradition gibt es Texte, die sind zu eng geworden. In meinem Viertel gibt es einen phantastischen Änderungsschneider. Er hat schon Hosen kürzer gemacht, Reißverschlüsse repariert, einen mottenzerfressenen Schal gestopft - alles so geändert, dass ich es wieder tragen mag. Ich glaube, so kann man auch mit alten Texten umgehen. Man kann sie ändern, damit sie wieder passen.
Bei www.monatslied.de gibt es eine wunderschön vertonte Version dieses Vater Unsers. Wir singen es oft in der Wohnzimmerkirche.
Restwärme

Der Engel hat sich auf Wollsocken genähert, erst in letzter Sekunde habe ich sein Kommen bemerkt. „Jedes Baby bringt eine Portion Geborgenheit auf die Welt“, sagt er. „Das ist eure Rettung. Damit ihr nicht abstumpft. Damit ihr nicht vergesst, wie das ist: Hilflos zu sein und trotzdem Willkommen. Selbst wenn die Umstände Mist sind.“ Ich zucke zusammen, seit wann klingt die Botschaft der Engel so derb? „Ist doch wahr“, sagt er. „Schau dir die Welt an. Ein Stall ist eine Wellnessoase dagegen. Ihr müsst dringend ausmisten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden!“ ruft er und verschwindet. Vielleicht ist das ein Zeichen, denke ich. Dass der Engel keiner von der abgehobenen Sorte ist. Sondern weiß, wovon er spricht. Vielleicht ist dann ja auch das andere wahr: Euch ist heute ein Retter geboren. Ein Kind in Windeln. Im Dunkel zur Welt gekommen, als alle schwarz sahen. Hat ein paar Menschenseelen erwärmt und ist weitergezogen. Aber etwas bleibt. Als wäre eben noch jemand dagewesen. Restwärme fürs Herz.
Helle Tage, gesegnete Nächte, frohe Weihnachten!
Still

Am Morgen jenes fernen Tages rasierte sich Zacharias sorgfältiger als sonst. An jenem Morgen zog er sein bestes Hemd an, das mit den Perlmuttknöpfen. Das hatte er lang nicht mehr gemacht.
Elisabeth sah ihn an und dachte, dass er alt geworden war. Ein alter Mann mit zwei Falten um den Mund und tiefer Melancholie im Blick. Ach du, dachte sie.
Im Haus war es still. Viel zu still. Zacharias räusperte sich, er konnte die Stille nicht gut ertragen. Hier hätten seine Enkel lachen sollen. Er hatte sich immer ein volles Haus gewünscht, kommen und gehen, klein und groß, Elisabeth und er, sie beide mittendrinn. Aber es war kein Kind gekommen. Kein einziges. Elisabeth wurde älter, ihre Versuche wurden routinierter und bekamen schließlich den Beigeschmack der Verzweiflung.
Elisabeth fühlte sich wund an, wundgehofft, und er fühlte sich schuldig. Und auch betrogen um ein Leben, das sie verdient hätten. Sie hörten auf, darüber zu reden. Und irgendwann hörte Zacharias auch auf, dafür zu beten. Denn auch Gott blieb stumm.
Zacharias war Priester, einer von Tausenden, aber immerhin nicht in einem verlorenen Dorf am Ende der Welt, sondern im Tempel. Im Zentrum. Da, wo immer etwas los war. Einer, der anderen Hoffnung machte, ohne selber noch Hoffnung zu haben. Aber er war gut darin. Er war wirklich gut.
An jenem Tag also war er an der Reihe, das Rauchopfer bringen. Deshalb das Hemd. Zacharias küsste Elisabeth flüchtig auf die Wange. „Bis später, Schatz.“
Im Tempel war es bereits voll. Pilgerinnen, Touristengruppen, Gläubige, Krimskramsverkäufer. Zacharias entdeckte ein paar bekannte Gesichter und setzte sein Priestergesicht auf. Warm und verbindlich. Er prüfte, ob die Kohlen glühten, der Weihrauch lag bereit. Die Zeremonie begann. Es wurde still. Zacharias sprach die Heiligen Worte, er kannte sie in und auswendig. Kurz schweifte er ab und dachte, dass er versprochen hatte, später Lammbraten zu besorgen, aber er holte sich zurück und versuchte, mehr Bewegtheit in seine Stimme zu legen. Dann ging er hinein ins Allerheiligste, dorthin durfte ihm niemand folgen. Hier war er allein mit Gott. Was für eine Vorstellung, dachte er. Und dann dachte er kurz, was er Gott sagen würde, wenn Gott wirklich hier wäre. Aber der Raum war leer, bis auf das Gold, das trotzdem glänzte. Stop, ermahnte Zacharias sich. Dies ist nicht der Ort für Zweifel.
Er nahm die Schale mit dem Weihrauch und sah den Engel. Unzweifelhaft stand er da, direkt neben dem Altar. Zacharias wollte etwas sagen, aber was?
„Hab keine Angst“, hörte er. „Euer Wunsch wird sich erfüllen. Elisabeth wird schwanger und ihr bekommt ein Kind und ihr werdet überglücklich sein.“
In Zacharias Kopf stürzte etwas ein. Jetzt hätte er jubeln müssen, hier war das Wunder, das er so lang herbeigesehnt hatte. Aber das einzige, was er dachte, war: Warum? Warum jetzt? All die Jahre, in denen wir so gehofft haben. In denen wir alles versuchten. In denen wir das Glück der anderen gesehen haben, all die vielen bitteren Jahre. Der mühsame Weg, abzuschließen. Und jetzt wieder anfangen? Von neuem anfangen zu hoffen? Zacharias spürte nichts.
„Wie kann ich mir sicher sein“, fragte er. „Wie kann ich wissen, dass es dieses Mal klappt, dass wir nicht wieder enttäuscht werden. Und wie soll das gehen? Es ist zu spät. Wir sind alt. Da wächst nichts mehr. Ich kann das auch nicht mehr, ich…“
„Still“, sagte der Engel und brachte Zacharias mit einer sanften Geste zum Schweigen. „Es liegt nicht an dir. Rede dir nichts ein. Das Leben wird wachsen.“ „Aber“, wollte Zacharias einwenden, tausend Abers lagen auf seiner Zunge. Aber sie kamen nicht raus. Kein einziges Aber kam über seine Lippen.
Draußen vor dem Tempel wunderten sie sich, wo Zacharias blieb. Als er schließlich herauskam, geschah etwas Merkwürdiges. Der Segen blieb ungesprochen. Als hätte es ihm die Sprache verschlagen. Zacharias schwieg und ging.
Er zog in einen Raum aus Stille. Neun Monate lang wohnte er darin. Neun lange Monate sprach er kein einziges Wort. Seine Stimme fing damit an. Sein Herz wurde ruhig. Die Zweifel verstummten. Irgendwann beruhigte sich auch der Zorn und sein wundgeglaubtes Herz erholte sich.
erzählt in der Wohnzimmerkirche
Superkraft

Am 21. November steht Kim an Omas Bett und denkt: „Das ist so typisch für Oma, dass sie kurz vorm Advent beschließt zu sterben.“ „Da seh ich schon die Lichter im Himmel“, lacht Oma, weil draußen jemand Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt hat. Trotz Energiesparen. Ein bisschen Licht muss sein, das findet auch Kim und strafft die Schultern. Jetzt bloß stark sein. „Ach stark“, sagt Oma, „immer diese olle Stärke. Wem willst du was beweisen? Guck mich an: Ich schaffe es nicht mal mehr, meine Kaffeetasse zu heben. Willst du etwa, dass ich so tue, als sei ich morgen wieder topfit? “ Kim schaut auf Omas dünne Handgelenke und die gläserne Haut und denkt: „Nee. Das wäre ja noch schwerer auszuhalten.“ „Siehste“, sagt Oma, weil ihre Superkraft schon immer Gedankenlesen war. „Kind“, sagt sie, obwohl Kim natürlich längst kein Kind mehr ist. „Ich sag dir eins: Wenn du glücklich sein willst, tu nicht immer so, als sei alles in Butter. Stärke ist eine Illusion. Such dir eine andere Superkraft.“ Dann lächelt sie ihr Omalächeln. „So, und nun sing mir was vor.“ Kim kann nichts singen außer „Alle Jahre wieder“. Das mussten sie in der vierten Klasse mal auswendig lernen. Bei „Geht auf allen Wegen // Mit uns ein und aus“ stirbt Oma, aber Kim singt tapfer weiter.
Samstag vorm ersten Advent wird Oma begraben. Im Ganzen, so hat sie das gewollt. Ein letztes Mal das Ausgehkleid tragen, mit Silberbrosche und dem geerbten Fuchsschwanz. „Wird ja auch wirklich Zeit, dass der endlich unter die Erde kommt“, hatte Oma gelacht. Vielleicht ist Humor auch eine Superkraft, denkt Kim und wirft einen Schokonikolaus ins offene Grab. Vollmilch natürlich. Bitteres gibt es ohnehin schon genug. Dann gehen alle zum Kaffeetrinken....
Die ganze Geschichte lesen:
Kann man auch hören: Deutschlandfunk, zum 1. Advent: hier zum Nachhören
Heilmittel

Thomas von Aquin, 13. Jh., handschriftlicher Zusatz (Echtheit noch unbestätigt)
Frühstücksei

Ich mag nur das Gelbe vom Ei. Am liebsten in diesem perfekt cremigen Zustand, nicht zu flüssig, aber auch nicht bröselig. Wenn ich ein Frühstücksei essen möchte, brauche ich also einen Mitesser. Oder eine Mitesserin, also eine Person, die lieber das Weiße mag. Das ist mir zwar unerklärlich, aber es gibt solche Menschen. Einmal traf ich einen kleinen Jungen, der war so einer. Wir wären ein perfektes Team gewesen, aber der Vater verbot es ihm. Er hatte seine Grundsätze: Der Junge müsse lernen, dass man sich nicht nur die Rosinen herauspicken dürfe.
Rosinenbrot schmeckt sehr gut mit Ei. Manche legen noch eine Scheibe Schinken darunter. Das würde ich nicht, aber sollen sie. Für mich reicht Butter. Vielleicht noch etwas Orangenmarmelade, Sanddorngelee ist auch fein. Was ich sagen will, ist: Es gibt sehr viele Möglichkeiten zu genießen. Man braucht keinen Glaubens-krieg daraus zu machen. Die Welt ist voller Köstlichkeiten, wir können sie einfach teilen. Frieden fängt beim Frühstücksei an.
Ministerin für transzendentale Sicherheit

Sehr geehrte Damen und Herren, du lieber Himmel,
wir müssen jetzt ganz stark sein: Sicherheit gibt es nicht. Das Konzept Welt ist in ständigem Wandel und niemand garantiert, dass das Spaß macht. Nicht mal, dass es instagrammabel ist. Soweit die schlechte Nachricht, jetzt die gute: Wir sind nicht allein. Verzeiht, wenn das wie Hohn klingt angesichts von Klimawandel-Leugnerinnen, Rechtsnationalen und größenwahnsinnigen Autokraten. Wir können uns darüber die Haare raufen oder ein Fort aus Decken bauen, wir können uns in unsere Höhlen verkriechen, netflixen oder – atmen.
Der Gedanke, dass acht Milliarden Menschen einmal am Tag nichts anderes tun als Atmen, wäre ein beruhigender Gedanke. Und Ruhe ist ein anderes Wort für Sicherheit. Damit meine ich nicht diese bedrohliche Ruhe vor dem Sturm, nicht die lähmende Ruhe, keine Kaninchen-vor-der-Schlange Ruhe und auch nicht diese Art von Ruhe, wenn in der SBahn alle auf ihr Handy starren. Ich denke an Ruhe, die verbindet: Hallo Gott. Ich bin hier. Du bist hier. Das reicht. Ich bin hier. Du bist hier. Das reicht. Auch wenn ich keinen Plan habe. Wenn ich mich im Gestrüpp eines zu vollen Alltags verliere. Wenn eine Flut von Scheißnachrichten runterzieht. Halten wir stand, ohne Held*innen zu sein. Eine halbe Stunde am Tag: Ich bin hier. Du bist hier. Das reicht. Listen and repeat.
Dreamer

Matze ist ein Klischee. Sein Schädel ist kahlgeschoren, sein Körper volltätowiert. Am Türrahmen hat er eine Strichliste für alle Nasen begonnen, die er schon gebrochen hat, aber irgendwann hat er den Überblick verloren. Bier ist sein Müsli. Nach einer kurzen, frühkindlichen Findungsphase hat er sich auf Hass spezialisiert.
Am 29. März spürt er, dass etwas mit ihm geschieht. Und allein das will schon was heißen. Spüren ist nicht Matzes Spezialgebiet. Irgendwas drängt ihn, an Katzenbabies zu denken, und erstaunlicherweise sind es keine Gedanken, die ertränken, erschlagen, anzünden beinhalten. Matze schüttelt sich. Schlägt mit der Pranke ein paar Mal ordentlich gegen seinen Schädel. Aber es geht nicht weg. Als nächstes ertappt er sich dabei, „Imagine“ zu summen. Er wusste nicht mal, dass das Lied in seinem passiven Erinnerungsschatz liegt. „Hä?“, grunzt Matze. „Was’n das für’n Geschwurbel?“ Die Melodie läuft unbeirrt weiter in seinem Kopf. Am Nachmittag schlichtet er Streit, kauft für Tanja ein Bund Margeriten, und als die Verkäuferin fragt, ob er einen Herzanhänger dazu möchte, nickt er beseelt. „Alter“, keucht er. „Ich muss krank sein!“ Zur Probe reißt er ein paar Autospiegel ab. Nichts. Kein Gefühl. Keine Befriedigung, im Gegenteil: Es drängt ihn, ein Entschuldigungsschreiben aufzusetzen. Einer tattrigen Oma hilft er über die Straße, und als sie die vielen bunten Bilder auf seiner Haut bewundert, sagt er artig „danke“. Den Rest gibt ihm eine humpelnde Taube, der er das Bein bandagiert. Matze K. kapituliert. Zum ersten Mal in seinem Leben. „You may say, I’m a Dreamer. But I’m not the only one…“
Opfer und Bauklötze und Wut

Es gibt
Leute, die explodieren regelmäßig. Wegen eines verspäteten Anschlusszugs oder der Sonntagsfahrer auf der Autobahn. Weil jemand keine Maske trägt, weil die Lasagne im Bistro auf sich warten lässt.
Weil die anderen anders leben wollen und keine Ahnung haben. Zugbegleiter werden angeschrien, Polizistinnen, Mitarbeiter in sozialen Einrichtungen, Politikerinnen. Vom Internet erst gar nicht zu
reden. „Das musste mal raus“, scheint ein ausreichender Grund zu sein. Aber eine Gesellschaft ist kein Kindergarten. Da kann nicht einfach jeder losschreien, wenn ihm was nicht passt. Und selbst
im Kindergarten lernt man: du sollst deinen Nächsten nicht mit Bauklötzen bewerfen.
Was das mit Kain und Abel zu tun hat und warum ich nicht glaube, dass Gott Opfer braucht: Deutschlandradio Kultur
Wer bist du?

Ich bin seit 49 Jahren Mensch. Im Körper einer Frau. Manchmal fällt mir das auf, aber eigentlich ist es so selbstverständlich, wie eine Nase zu haben. Ich kann gut zuhören, aber nicht nähen. Ich mache gern Feuer, finde Röcke angenehmer als Hosen und mochte rosa schon, bevor es Prinzessin Lillifee trug. Ich habe keine Kinder geboren und bin glücklich damit. Ich fahre gern Auto, genieße es manchmal, mich anzulehnen und übernehme an anderen Tagen die Führung. Ich hasse es, mein Fahrrad zu flicken und freue mich, wenn jemand Spinnen aus dem Weg räumt. Eine Maus würde ich aber jederzeit auf die Hand nehmen. Manchmal bin ich härter als ich will. Ich koche täglich, eine Bratpfanne auf dem Geburtstagstisch wäre für mich keine Beleidigung. Fußballübertragungen langweilen mich, Fashionfragen auch. Ich habe eine Vulva und finde das gut, allerdings habe ich auch keinen Vergleich, wie es mit einem Penis wäre (etwas unpraktischer stelle ich es mir vor). Die Frage, ob ich mich weiblich fühle, spielt für meine Identität keine große Rolle. Ich bin ich. Ich fühle mich gut (jedenfalls im Großen und Ganzen). Und ich möchte in einer Welt leben, in der das jede und jeder von sich sagen kann. In der Menschen dieselben Rechte haben. Einen Rock tragen dürfen und einen Bart. An manchen Tagen zartbesaitet sind, an anderen gestählt. Alle Zeit der Welt mit Kindern verbringen dürfen, ohne sich zu erklären; mit einem Floß den Mississippi queren oder glücklich hinter Aktenordnern verschwinden. Mit Hüftschwung durch die Straßen gehen oder mit Stiernacken. Und das alles sollte keine Frage des Geschlechts sein, sondern der Sehnsucht: Wer bist du? Was entspricht dir? Ich möchte in einer Welt leben, in der es weniger Kategorien gibt und mehr Sein.
Geröll und Topfenstrudel

Ich bin auf einen Berg gestiegen, habe den Kühen gesagt, sie mögen auf ihrer Seite bleiben, bin über 100000 Kilo Geröll geschlittert, und am Ende bin ich in den See gesprungen und habe einen Saibling getroffen.
Die Freiheit war auch unterwegs, sie lief immer einen Schritt voraus. Manchmal saßen wir zusammen auf eine Stein. Ihre Nachbarin ist das Glück und eine Gams, beide sind etwas scheu.
Ich habe ein Käsebrötchen gegessen und keinen Topfenstudel. Obwohl er sich angeboten hat, aber das war mir zu aufdringlich. Die weiteren Aussichten sind unbestimmt. Das Handy sagt, ich solle es in den See werfen. Das sei auch Freiheit.
#schreibreise #kalkalpen
Pfingstbeflügelung

Ich glaube an Vorfreude
auf Honigbrot und Höhenflüge
weil im Moment davor alles möglich ist.
Ich glaube an Vergebung
Ich glaube, dass auch im Moment danach
Nichts unmöglich ist.
Ich glaube, dass Gott eine Zauberin ist.
Ich glaube an Schmetterlinge
Ich glaube an alle
die gerade Raupen sind
Halber Himmel

Morgens stehe ich aus dem Bett auf. Mittags vom Tisch. Aber vom Tod? Keine Ahnung. Ich glaube es versuchsweise, und wenn es dann nicht klappt, wenn dann alles schwarz und Schlaf ist, dann merke ich es ja nicht mehr. Bis dahin lebe ich. Esse Zimt-schnecken, halte meine Nase in die Sonne, stell mich in den Kirschblütenregen, streite (aber schmolle nicht) und feiere das Leben, so oft ich kann. Muss alles immer erfüllt sein? Ist es sowieso nicht, jedenfalls nicht in meinem Leben. Mir reicht ein halber Apfelkuchen, ich brauche keinen ganzen. Wer immer auf Erfüllung wartet, könnte am Ende mit leeren Händen dastehen. Ich möchte mich erinnern an ein paar spontane Ausflüge ans Meer, an das Lachen meiner kleinen Nachbarin, an Bring-was-du-hast-Abende, an Küsse im Nieselregen, an das ein oder andere gelesene Buch, an den Geruch von Waldmeister im Mai. Ich möchte mich daran erinnern, dass ich schon jetzt mehr Erinnerungen habe, als ich mir träumen ließe. Rette mich, Gott, vor der Vorstellung, dass immer noch was Größeres kommen muss. Der Himmel beginnt hier, mit einem halben Fuß steh ich schon drin.
Weniger ist Meer

Vielen Dank
für 20 rechte Hände
und das Rascheln der Bleistifte auf dem Papier
Vielen Dank für die Möwe,
die mein Eis verschont hat
Vielen Dank für das Glück,
frei zu sein und einfach auf eine Insel fahren zu können
Vielen Dank für Sanddorngelee
einen Platz im Strandkorb
und einen Morgen aus Gold
Vielen Dank für Dinge
die schon immer mal gesagt werden wollten - Brathering, Himmelsexpeditionen und die Geschichte eines Föns
Vielen Dank für das Meer
nicht weniger als das.
Eine Woche Schreibworkshop auf Langeoog.
Tschüss, bis nächstes Jahr!
Ich wünschte

Statusmeldung
Im Fernsehen weint ein Mann.
Er hat dieselben Leichen gesehen wie ich - aber in echt.
Ich schalte den Fernseher aus und koche Griesbrei.
Mit Omas Messer schneide ich einen Apfel.
Ich weine, dass die Welt nicht klüger wird.
Ich weine vor Entsetzen und rieche Vanille.
Von hier

Was ich von hier aus sehe
Rosa Blüten, die sich nicht einschüchtern lassen.
Sanftmut ist auch eine Stärke.
Ich trainiere täglich eine halbe Stunde:
Widersprechen in Fis-Dur.
Mit einem Rhinozeros auf Zehenspitzen tanzen.
Einen Streit als Stummfilm führen.
Zuversicht verstreuen. Mich besonnen.
Offener Brief an Gott

Wenn es dich gibt, warum greifst du nicht ein? Nein - halt, warte, das soll gar keine Frage sein, weil jetzt nicht die Zeit für philosophische Gedankenspiele ist. Wenn es dich gibt, dann tu was. Fall Herrn Putin in den Arm und seinen Mitstreitern auch. Du kannst einwenden, dass meine Bitte spät kommt, Kriege gibt es auf der Welt, solange ich lebe. Du hast recht. Aber ich bin - im Gegensatz zu dir - ein Mensch. Je näher das Unfassbare kommt, desto fassungsloser macht es mich. Ich habe kluge Bücher gelesen und mir Antworten zurechtgelegt, warum du das tust: Nichts tun. Dass du nicht kannst, ist so ein verstörender Gedanke. wenn nicht mal du - wie dann wir? Ich wage nicht, um Trost zu bitten, weil andere den viel dringender brauchen. Jede Bitte kommt mir falsch vor, weil hinter allen Bitten die eigentliche steht: Mach dem Töten ein Ende.
Ich fühle, dass es dich gibt. Ist das alles?, frage
Ich (gerade auf Flügeln der Morgenröte unterwegs)
Ungeduld

Als erstes wird der Frühling kommen. Und er kommt, soviel ist immerhin sicher. Und es wird Tage wie diesen geben, an denen die Sonne scheint, und der Himmel ist klar, und ich werde mich hinausträumen in den Wald, der hellgrün trägt und süß riecht. Und für einen Moment wird mich das beruhigen. Und dann wird mir das Lied von den Mandelzweigen in den Sinn kommen, das ich mich eigentlich schäme zu singen, weil es so eine naive Gott-macht-alles-gut-Haltung dahinträllert, aber plötzlich ist es erwachsen geworden und beharrt darauf, dass Waffen schweigen werden, die Lieder aber nicht. Und dass im Übrigen nicht ich Richterin zu sein brauche, der Job ist zu groß für mich, schon gar nicht Weltenrichterin. Die Stelle sei auch schon vergeben, sie säße wachsam auf ihrem Platz, ihre Engel leisteten Erste Hilfe, manchmal gelänge es ihnen auch einzugreifen, aber was solle man schon tun gegen abertausend Soldaten. Wo ist das Licht, frage ich, wenn Menschen sterben? Wie soll man da überhaupt ein Lied singen, wie soll man da glauben an die Vernunft, an die Liebe, an eine Zukunft, die gemeinsam stattfindet? Die Weltenrichterin wird weise ihre Antwort wägen, sie rechne in Jahrtausenden - und entschuldigt sich dafür, sie wisse, sie verstehe mittlerweile, was Ungeduld heiße, deshalb schicke sie Sonnentage und Frühling und Lieder und Engel, und alles, was sie habe.
Ohne Titel

’s ist Krieg! ’s ist Krieg! O Gottes Engel wehre,
Und rede Du darein!
’s ist leider Krieg – und ich begehre,
Nicht schuld daran zu sein!
Matthias Claudius, 1778
Ich will mich verkriechen. Russland hat die Ukraine angegriffen. Es ist Krieg. Dagegen wirkt Corona blass. Ich muss mich zwingen zu arbeiten (weil mir nichts besseres einfällt). Wann wird es wieder gut sein? Wann wird man rausgehen können und die wichtigste Nachricht des Tages ist eine neue Bucherscheinung oder die Ankunft der Zugvögel?
Gestern saß ich in der Kirche und sah, wie ein Sonnenstrahl den Flügel eines Engels streifte, während in den Nachrichten Bomben fielen. Der Engel hielt einen Siegeskranz in den Händen, Frieden ruft er, und ich halte mich fest an der Hoffnung, dieser Engel sei längst unterwegs.
Staub und grüner Klee

Glaubst du an Gott? Und wenn ja: Glauben du, dass Gott etwas Bestimmtes mit dir vorhat? Dass da ein eingespeicherter Plan ist, der deinem Dasein einen Sinn gibt?
Ich glaube an Gott. An einen Plan glaube ich nicht. Obwohl mir der Gedanke gefallen würde: Mit einer Mission unterwegs zu sein. Bei der jede vertrödelte halbe Stunde an der Bushaltestelle, jede schlaflose Nacht einen Sinn bekäme. Eine Mission, die bestimmte Fragen ein für alle Mal klärt: Wofür ich aufstehen soll. Ob Abwasch oder Twitter gerade wichtiger ist. Welche Freizeitbeschäftigung mich erfüllt. Eine Mission, der ich zielgerichtet durch den Alltag folge. Eine Mission, die aus mir eine Superheldin macht.
Aber Gott schüttelt den Kopf: „Nope. Keine Mission für dich. Die schlechte Nachricht ist: Ich brauche dich nicht.“ Das muss erstmal sacken. In der Sache überrascht mich das nicht wirklich, aber etwas mehr Behutsamkeit hätte ich von Gott schon erwartet. Zwar bilde ich mir nicht ein, unersetzlich zu sein. Schon gar nicht weltweit betrachtet. Aber es wäre schön zu wissen: Susanne, die ist dafür da, dass 17,3 % ihres Umfeldes weniger streiten. Noch besser wäre natürlich etwas Größeres. Susanne soll eine Pyramide bauen. Zum Beispiel. Etwas Konkretes, an dem man arbeiten kann im Leben. Zeichnungen anfertigen, Räume ausmessen, Steine hauen, Mittagspause machen und ein Käsebrot essen. Start and Repeat. „Die Welt braucht keine Pyramiden mehr“, holt mich Gott zurück. Ich frage: „Was dann?“
Gott räuspert sich: „Ich zitiere: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was ich von dir will: Gerechtigkeit tun, Freundlichkeit lieben, und demütig mitgehen mit deinem Gott. Die Bibel, Buch Micha, Kapitel 6.“
Ich zucke zusammen. Demut. Wirklich? Das verstaubteste aller Mutworte?
Was die gute Nachricht ist und warum Demut ein Mutwort ist, das nur auf den ersten Blick schüchtern wirkt, erzähle ich hier:
Weiterlesen oder hören: Deutschlandfunk Kultur
Neulich auf dem Weg zum Bahnhof

Jesus treibt sich auch wieder in den schummrigsten Ecken rum...
Lichtmess

Der Morgen leuchtet heller als der letzte Stern in meinem Fenster.
Zwischen Inzidenzen wachsen Krokusse. In die Nachrichten mischt sich das Lied einer Amsel. Ich packe mein Weihnachts-Ich in Holzwolle, falte die Decke zusammen und verlasse die Enge des Stalls. Irgendwas kommt mir entgegen. Ich weiß noch nicht was, aber es wird sich lichten. Täglich 3,41 Minuten mehr.
Frohe Weihnachten!

Dass Weihnachten ein Fest für Naive sei, lese ich, weil niemand die Welt retten kann. Schon gar nicht ein Kind, auch in 2000 Jahren nicht. Dann will ich naiv sein. Wenigstens einmal im Jahr will ich meiner Kinderseele recht geben, die darauf besteht, dass Herbergen sich öffnen. Die glaubt, dass es solche Nächte gibt, in denen Rosen blühen und das Eis schmilzt. Wenigstens einmal im Jahr sollen die Herzen weich werden und durchlässig, damit wir nicht verlernen, wie das geht. Soll die Sehnsucht Raum finden, damit wir nicht verrohen. Mag sein, dass das die Welt nicht ändert. Aber uns.
Lieber Sonntag,

jede Woche freue ich mich auf deinen Besuch. Du bringst Brötchen mit oder Kuchen, und immer nimmst du dir einen ganzen Tag Zeit. Früher konnte ich nicht so viel mit dir anfangen. Da hielt ich dich für etwas verschroben. Jetzt mag ich das. Dass du so anders bist. Mit dir kann man Pläne schmieden, auf dem Sofa lümmeln, in dicken Büchern versinken, die Zukunft rosa färben, eine geheime Sprache erfinden, mit dir kann man den Himmel stürmen. Du bist zwecklos, und das entspannt mich. Du willst nichts von mir. Du stellst Fragen, für die ich sonst nie Zeit habe: Wofür ich lebe. Was mich glücklich macht. Was ich der Welt geben will. Ob Himbeeren was mit Himmel zu tun haben. Ich mag auch deine Fürsorge. Du hast ein Auge auf mich. Siehst, wenn ich müde bin, und dann machen wir einen Mittagsschlaf. Wenn ich Wind um die Nase brauche, ziehst du mich raus. Manchmal redest du mir ins Gewissen: "Mach mal was, das du nicht musst. Heute gehörst du mir - und ich gebe dir frei." Das ist deine Art der Liebeserklärung. Du bist ein Schatz!
Unser Kalender für 52 unverbrauchte Sonntage ist fertig: Luft nach oben 2022! Den Kalender könnt Ihr hier bestellen.
Advent

An einem Herbstmorgen
hol die rote Mütze raus
nimm die Einsamkeit von der Stirn
schreib einen Brief auf Zeitungspapier
bau deinen Himmel aus Atemwolken
der Engel ist Zigaretten holen
warte nicht
Nocheinmal!

Für alle halb gelebten Leben
und für alle himmelhohen Träume.
Für alle missglückten Anfänge
und für das Glück, das noch aussteht.
Für alle Liebe, die auf der Strecke blieb
und trotzdem nicht verloren ist.
Für alle kühnen Versprechen und auch für die Halbherzigkeit.
Für alles Scheitern, für alles Nocheinmal.
Für das, was offen ist.
Für die angebrannten Kekse und das halbvolle Glas.
Für das Hoffen und das Sehnen.
Für viel zu große Schuhe und klitzekleine Schritte.
Für die Lust, für die Leichtigkeit.
Für uns, Held*innen und Hasenfüße.
Wohnzimmerkirche

Warum ich Wohnzimmerkirche so mag:
weil der Raum offen ist und das Licht weich. Vieles ist in der Schwebe. Vielleicht auch Gott. Niemand hat den Gral. Oder alle. Weil Jan so wunderschön unspektakulär singt. Ohne Wehr und Waffen. Weil Gedanken im Reden entstehen. Miteinander reden. Liebe schmeckt nach Cider und macht nicht viel Aufheben. Ist einfach da. Und weil manchmal schon eine bunte Lichterkette und ein paar Gleichgesinnte genug sind.
Andererseits

Einerseits ist nun leider November. Andererseits leuchten die Ahornbäume nie schöner als jetzt. Auf meiner Liste rangeln die To-dos um den ersten Platz. Andererseits ist morgen sowieso Wochenende. Meine Friseurin sagt, keiner hat mehr Lust auf Corona. Ich auch nicht. Also muss ich lernen, für meinen Lockdown selbst zu sorgen, wenn alles zu eng wird. Ein Freund ist begraben. Die Motten im Keller lassen sich nicht unterkriegen. Ich wünschte, es wäre andersherum. Das Leben richtet sich nicht nach meinem Wunschzettel, jedenfalls nicht zuverlässig. Ich schreibe trotzdem einen, mindestens in Gedanken. Wünsche halten das Herz warm. Drinnen riecht es nach Heizungsluft, andererseits habe ich endlich wieder eine Heizung und keinen Nachtspeicher mehr. Letzte Woche hat sich im Traum der Himmel geöffnet. Wunschdenken sagen die einen. Trotzdem bleibt ein Leuchten zurück.
Drinnen

Vergesst nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt.
Die Bibel, 1. Korinther 6, 19-20
Auf der Suche nach Gott tritt sie in die Kirche. Die Tür ist offen. Drinnen brennen Kerzen und es riecht nach Nelken, die jemand auf den Altar gestellt hat. Sie setzt sich. Lange war sie nicht mehr hier. Doch schon bald tut ihr auf der harten Bank der Rücken weh. „Das musst du aushalten“, ermahnt sie sich, aber vor lauter Aushalten vergisst sie, wonach sie sucht, und nach einer halben Stunde geht sie unverrichteter Dinge nach Hause.
Gott hat sie sich immer erhaben vorgestellt. Einer, der in einem Haus wohnte, dessen Säulen in den Himmel ragen, muss einfach erhaben sein. Gold ist sein Kleid. Ihre Kleider dagegen hängen wie Säcke an ihrem unförmigen Körper. Das hat ihre Mutter mal gesagt, und sie hat es nie vergessen. Obwohl es schon Jahrzehnte zurückliegt. Heute sieht sie auf Instagram Pastellfotos lichtgefluteter Frauen, deren feingliedrige Hände einen Becher Kräutertee mit dem schönen Namen „Seelenzauber“ umfassen. Manchmal lächeln sie auch aus einer komplizierten Yoga-Pose entspannt in die Kamera. Dazu posten sie das Hashtag #Selbstliebe, als sei es das Normalste von der Welt. Ihr ist das fremd. Sie würde wetten, dass ihre Mutter das Wort nicht mal kennt. „Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach…“, murmelte sie Woche für Woche. Die Hände gefaltet, den Kopf gesenkt. Selbstliebe klingt verdächtig nach Eitelkeit, denkt sie. Eine der Hauptsünden, hat sie gelernt. Die von Gott ablenken.
In dieser Nacht träumt sie, dass sie mit Gott verstecken spielt. Auf einmal ist sie wieder Kind in ihrem rotgepunkteten Lieblingsrock. „Mäuschen, sag mal Piep!“, ruft sie, und Gott ruft „Piep!“ Aber sie kann Gott nirgends finden, nicht hinterm Sofa, nicht unterm Bett, nicht im Schrank. „Näher“, flüstert Gott, „viel näher“, und die Stimme scheint eindeutig aus ihrem Bauch zu kommen.
Was man für einen Unsinn zusammenträumt, denkt sie beim Aufwachen. Trotzdem cremt sie sich an diesem Morgen besonders sorgfältig ein. Sie lässt keinen Zentimeter und keine Delle ihres Körpers aus, der plötzlich so viel mehr sein könnte, als eine unvollkommene Hülle für Herz, Niere, Lunge und ein paar Meter Blutgefäße.
Sternchen

Das ZDF gendert Islamist*innen. Viele finden das blöd. Ich finde es gut. Solange man kein Dogma daraus macht. Nicht bei jedem vergessenen „innen“ eine Grundsatzdiskussion beginnt, nicht wegen eines kleinen Sternchen den Weltuntergang wittert. Meine Aufgabe ist es, kreativ damit umzugehen. Eine Sprache zu finden, die schön und präzise ist und den Horizont weitet. Das ist manchmal tricky, aber das ist es auch ohne Gendersternchen. Ich sehe es als Herausforderung. Und ich mag Herausforderungen. Als ich „Islamist*innen“ las, habe ich mich natürlich sofort gefragt, wieviel weibliche es wohl gibt. Und wie viele, die sich keinem Geschlecht oder beiden zuordnen. Letztere tendieren wahrscheinlich gegen Null. Zumindest jene, die sich das eingestehen. Dabei könnte es sie trotzdem geben. Das Sternchen macht die Welt und mein Denken mehrdimensionaler.
Ich schreibe selten über Islamist*innen und mehr über Gott. Dass Gott kein Er ist und keine Sie, ist sowieso klar. Trotzdem wird oft so gesprochen, als sei Gott ein mittelalter Mann mit Hut. Wieso reden wir immer noch so? Herr, Vater, Schöpfer, Er. Ich weiß: Grammatikalisch ist das eine Herausforderung, weil Gott im Deutschen genauso männlich ist wie der Baum und der Apfel. Ich habe mein halbes christliches Leben damit verbracht, zu übersetzen. Mitgemeint zu sein, wenn von Brüdern die Rede ist oder von Christen. Neben die Metapher des Vaters die Mutter gesetzt (und immer gedacht: Ziemlich doof, wenn jemand mit einem oder beiden Elternteilen nichts Gutes verbindet. Was ja nicht so selten ist.). Meine Vorstellung von Gott ist integrativ. Jeden und jede zu sehen, weiter, offener, liebender als ich das kann.
Schäm dich. Nicht.

Als Adam und Eva einander kennenlernten, war alles unkompliziert. Hatte Adam einen Bauchansatz? Waren Evas Beine rasiert, lag ihr Bodymassindex im grünen Bereich? War Adam ein echter Mann, war Eva eine richtige Frau? Wir wissen es nicht. Alles, was berichtet wird, ist: Sie waren nackt und schämten sich nicht. Offenbar gab es nichts zu verheimlichen und nichts zu retuschieren. Sie waren, wie sie waren, und das war gut.
Anfang zwanzig wurde ich zum ersten Mal mit den Haaren auf meinem Körper konfrontiert und der Ansage, dass sie da nichts zu suchen haben. Bislang hatte ich sie zur Kenntnis genommen wie meine Ohrläppchen und meinen linken kleinen Zeh. Sie waren eben da, benötigten aber keine besondere Aufmerksamkeit. Auf einmal wurden sie peinlich. Ich lernte, mich zu rasieren und mich zu schämen, wenn ich es vergaß. Heute gibt es in sozialen Netzwerken ernsthafte Diskussionen darüber, wie schlimm es ist, wenn Frau (zuweilen auch Mann) Körperhaar zeigt. Und nicht nur darüber – auch über die Lücke zwischen den Oberschenkeln und die Optik der Schamlippen kursieren Schönheitsvorgaben. Bodyshaming nennt man die Ansage, wenn nicht alles passt.
Scham ist ein fieses Gefühl. Es suggeriert: Du bist nicht richtig. Du gehörst nicht dazu. Wie kannst du es wagen, dich so zu zeigen? Körperbehaarung ist da noch ein vergleichsweise kleines Problem. Man kann sich schämen, arm zu sein, die Verhaltenscodes für eine bestimmte Gruppe nicht zu kennen, keine Kinder oder zu viele Kinder zu haben, den falschen Beruf auszuüben und „nur“ Putzkraft zu sein. Menschen schämen sich, gemobbt oder missbraucht worden zu sein. Man kann sich schämen, da zu sein...
Scham ist ein ambivalentes Gefühl. Zu viel davon tut nicht gut – es macht uns kleiner, als wir sind. Zu wenig davon tut auch nicht gut – es macht uns größer, als wir sind. Scham ist die innere Stimme, die sagt: Du bist nicht Gott. Brauchst du auch nicht zu sein.
(...)
„Der liebe Gott sieht alles“, habe ich irgendwann gehört. In einem Kinderlied aus den 1970ern heißt es: „Pass auf, kleines Auge, was du siehst! Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst! Pass auf, kleine Hand, was du tust! Pass auf, kleines Herz, was du glaubst! Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich…“
Gott als großer Stalker. Als verlängerter Arm irdischer Moral: Gott sieht, wenn du auf Mama und Papa wütend bist. Wenn du Kekse aus der Dose klaust. Gott sieht, wenn du heimlich rauchst, wenn du masturbierst, wenn du davon träumst, deinen Schwarm aus der Nachbarklasse zu küssen. Gott sieht all deine Gedanken. Über allem schwebt das Damoklesschwert der Scham. Denn wie wahrscheinlich ist es, einen solchen Gott zufriedenzustellen?
Ich glaube nicht, dass Gott ein Aufpasser ist. Ich glaube auch nicht, dass Gottes Blick beschämt. Er richtet auf.
Adam und Eva haben viele Nachkommen. Sie sind Allerweltsmenschen und tragen unsere Namen. Adam ist ein Angsthase. Eva will endlich aufhören, ihre Körperhaare zu entfernen. Simon wohnt im Nachbarhaus und liebt Joschua. Werner singt im Kirchenchor und träumt manchmal von Sachen, die er keinem erzählen würde. Elisabeth träumt mit 79 immer noch von Sex – und schläft mit einem jüngeren Mann. Klaus weint, wenn er den Soldaten James Ryan sieht und wenn er im Stadion die Nationalhymne singt. Esther kocht für sieben Enkel und weigert sich, zur Sportgruppe zu gehen. Ben pflückt Blumen und spielt gern Paintball. Janne baut lieber ein Bücherregal anstatt zu bügeln. Michael träumt davon, Michaela zu heißen. Christiane ist es manchmal unangenehm, einfach nur Mutter zu sein und liebt es trotzdem. Kemal will der Stärkste sein und dennoch zärtlich. Laya wird Physikerin und kauft Kuchen eingeschweißt im Supermarkt. Oliver neigt zur Hochstapelei und besitzt gleichzeitig eine gute Portion Selbstironie. Maren liebt Tom und liebt Yasmin.
Und für nichts davon, aber auch für gar nichts davon brauchen sie sich zu schämen.
Weil ein wohlwollender, zutiefst freundlicher Blick auf ihnen ruht, der sagt: Du bist richtig. Dieser Blick gilt jedem Menschen, und wer das vergisst, kann sich erinnern, wenn das Gefühl, falsch zu sein, groß ist: Du bist sehr gut.
Ganzen Artikel lesen oder hören: Am Sonntagmorgen. Deutschlandfunk
Saumselig

Heute war ein guter Tag. Ich habe keine Wand gestrichen, auch habe ich den Kühlschrank nicht abgetaut. Ich habe kein Problem gelöst, nicht ein einziges. Aber auch keines schlimmer gemacht. Das Gras ist ungemäht geblieben. Die Zeitung liegt ungelesen auf dem Küchentisch. Ich habe mich nicht angestrengt, mein Geld habe ich nicht vermehrt (ich wüsste auch nicht, wie). Ich bin mit niemandem in Streit geraten, habe nichts besser gewusst, und auch die Zeit habe ich nicht versucht, anzuhalten.
Saumselig bin ich durch den Tag gegangen. Das ist ein Wort, das auf der Zunge zergeht. Versäumen steckt darin. Manchmal muss man was ausfallen lassen, damit das Glück einen antrifft. Meine Seele ist sehr glücklich darüber, abkömmlich zu sein. Sie ist unterwegs in anderen Sphären, ist Zitronenfaltern hinterher-geflogen und hat Himbeeren gepflückt. Gegen Mittag habe ich sie im Gras liegen sehen, ihre Träume waren blau. Abends hatte sie dann so ein Lächeln im Gesicht, als wüsste sie etwas, das ich noch
nicht weiß. Eine Ahnung von mir, wie ich bin, wenn ich nicht muss.
Kann man auch hören: NDR-Moment Mal
Zugreifen

Der Dienstag vor 2000 Jahren begann nicht gut. Der Himmel ist bewölkt. Die Brotpreise steigen. Es gibt Hassbotschaften, selbst aus unserem Netz. Wir brauchen eine Pause, das ist offensichtlich. Also brechen wir auf und verschwinden. Denn das habe ich gelernt in dieser Zeit: dass man es nicht allen recht machen kann.
Aber wir bleiben nicht allein. Andere kommen dazu. Leute, die wir noch nie gesehen haben. Wir setzen uns ins Gras. Es liegt was in der Luft: Etwas Unvollendetes, eine Sehnsucht, die sich heute Abend erfüllen könnte. Ich bin das Licht, sagt Jesus, und die Leute halten ihre Gesichter in die Sonne. Ich bin das Brot, sagt er. Ich schließe die Augen und lasse die Worte auf der Zunge zergehen.
Es ist spät, flüstert Petrus. Die Leute haben Hunger. Und dass wir jetzt mal was organisieren müssten. Ich schließe meine Augen wieder. Ich will nichts organisieren.
Am Horizont erscheint der erste Stern. Schickt sie nicht weg, sagt Jesus. Es ist so schön. Gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben fünf Brote, zwei Fische und einen angebissenen Apfel. Jesus sieht zum Himmel und dankt dafür. Ich kenne niemanden sonst, der für einen angebissenen Apfel dankt. Für das Wenige, das Halbe, das Unvorbereitete. Das, was jetzt da ist. Mein Herz klopft, als er uns das Brot gibt. Nehmt, sagt er. Gebt. Wir reichen weiter, was wir haben. Ohne abzuzählen. Ohne uns zu versichern, dass es genug ist. Wir machen einfach. Die Mutigen greifen zu. Schmecken. Kosten den Moment und genießen. Keiner beschwert sich, dass es zu wenig ist. Niemand drängelt. Alle machen mit. Die Angst, es könnte nicht reichen, verschwindet. Über die Wiese wehen Worte und Lachen, jemand holt eine Mundharmonika raus. Es ist längst dunkel geworden, aber niemand will gehen. Ist das ein Wunder?
Neustart
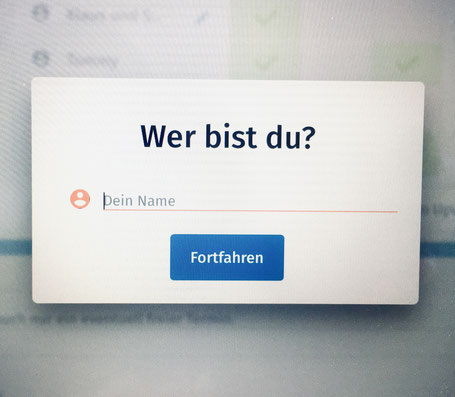
Als um 12 Uhr 17 die Welt neugestartet wird, hat Heiner mal wieder nichts mitbekommen. Dabei haben sie es auf allen Sendern gebracht: Dass man alle Anwendungen schließen solle. Was nicht gespeichert ist, ginge verloren. Vorsorgliche Menschen haben Sicherungskopien ihren Lebens gemacht, um genau dort wieder beginnen zu können, wo sie aufgehört hatten. Heiner natürlich nicht. Er hätte nicht mal gewusst, wie das geht.
Plötzlich ist alles so aufgeräumt. Nirgends hakt es mehr. Kein Update wartet. Stattdessen liegt etwas Neues in der Luft. Während die einen panisch versuchen, einen Techniker zu bekommen, der ihr altes Leben wiederherstellt, feiern die anderen, dass die Schulden gelöscht, Viren verschwunden und auch der Streit mit Isabelle aus der Welt ist. Heiner kratzt sich am Kopf, und dann öffnet er ein neues Fenster. Die Zukunft wird sich zeigen.
Pfingsten reloaded

In jenen Tagen geschah es, dass sie hinter verschlossenen Türen saßen und ihre Gesichter grau geworden waren und ihre Worte drehten sich im Kreis. Gremien wurden berufen und Ausschüsse gebildet und Antworten wurden an Fachleute delegiert und der Kleinmut hatte sich breitgemacht. Da wundert sich Gott: „Welche Fachleute denn? Die Fachleute, das seid doch ihr. Habe ich denn einige höhergestellt als andere? Habe ich meine Worte exklusiv verteilt? Ich habe sie in euren Mund gelegt und die Begeisterung in euer Herz.“ „Aber wir“, sagen sie, „wir wissen doch auch nicht. Einer glaubt so, die andere so. Wir sind so verschieden, wir können uns nicht einigen. Wir haben siebenundneunzig Punkte auf der Tagesordnung, und wenn wir fertig sind, dann fangen wir wieder von vorn an, weil niemand uns versteht!“ Da öffnet Gott die Türen und reißt die Fenster auf, dass Wind in die Sache kommt und die Angst fortpustet und Friederike fühlt sich plötzlich beschwingt wie nach einer halben Flasche Champagner. Der Herr Bischof spürt ein Beben in seinem Herzen und ist so erleichtert, weil er mit seiner Liebe nicht mehr hinterm Berg halten muss. Egon Hinterwald wundert sich, dass man alles auch ganz anders sehen kann, als er es tut, aber noch mehr wundert ihn, dass ihn das gar nicht mehr ängstigt. Hilde aus dem Frauenkreis lernt von Janne, was „queer“ bedeutet und beide spüren eine Weite im Kopf, als hätten sie nach Jahren den Dachboden entrümpelt. Worte wie Sehnsucht, Großmut, Gnade leuchten auf. Nichts davon lässt sich in Stein meißeln. Zwischen den alten Mauern wird es eng. Gott ruft: „Wer hat gesagt, dass Ihr Mauern braucht?“ Ein Hauch genügt, sie zum Einsturz zu bringen und Himmel breitet sich aus, schillernd und schön. Gemeinsam treten sie ins Freie, Friederike und der Herr Bischof, Hilde und Egon. Petrus und Phoebe sind dabei, Johanna und Jakobus. Herr Windli bringt seine Maria mit und Janne schwenkt eine Regenbogenflagge. Mireile singt ein gregorianisches Lied, nebenan setzen Technoklänge ein – und es ergänzt sich erstaunlich gut. Dazwischen schwebt Gott, überall zugleich. Alle haben sie gesehen, haben ihn gehört, haben es gespürt. Tausend Geschichten werden zu einer. Niemand will Recht haben. Macht ist ein vergessenes Wort, denn alle verstehen, was stark macht: Miteinander reden, voneinander lernen, aufeinander hören. Eine macht den anderen groß. Niemand will der Größte sein.
Und alle Welt beginnt zu staunen über jene, die leicht wirken und deren Worte nicht erschlagen, sondern prickeln wie Champagner oder weiße Johannisbeerschorle.
Als ich mit Jesus auf dem Balkon sitze

»Ich bin glücklich.«
Die Sonne ist gerade hinter den Häusern verschwunden. Du hast die Füße auf die Brüstung gelegt und balancierst auf deinem Bein ein Bitter Lemon.
»Überrascht dich das?«, fragst du.
»Ich weiß nicht. Glück ist so ein großes Wort. Muss man sich das nicht für die wirklich großen Momente aufsparen?«
Du lachst. »Hast du Angst, dass es sich abnutzt?«
Was weißt du schon vom Glück, frage ich mich stumm, um dich nicht zu verletzten. Du hörst es trotzdem.
»Du denkst, ich habe mein Glück geopfert. Für etwas Größeres. Aber so ist es nicht. Jetzt zum Beispiel möchte ich nichts lieber tun, als hier mit dir zu sitzen.«
Ich bin ein bisschen verlegen, weil ich mich freue.
»Ich kaufe Brot«, fährst du fort. »Ich helfe einem Gelähmten auf die Beine.
Wenn es einen Dämon zu vertreiben gibt, vertreibe ich ihn. Ich bete.
Ich wasche meine Füße. Ich kämpfe für so etwas Großes wie Gerechtigkeit.
Aber ich denke nicht darüber nach, ob ich lieber etwas anderes täte.
Oder woanders sein wollte.«
»Wirklich nie?«
Du schüttelst langsam den Kopf.
Deshalb also fühle ich mich so wohl bei dir.
aus: Schau hin. Vom Hellersehen und Entdecken
Nach einem Zoom-intensiven Wochenende

Gott zoomt jetzt oft. Wo er sich seltener unter die Leute mischen kann. Früher saß er freitags oft in der Kneipe neben Monika, und wenn es spät wurde, dann hakte er den Hans unter und passte auf, dass er nicht über einen Bordstein stolperte. Aber die Kneipen haben zu. Hans sitzt viel zu oft allein in seinem Zimmer. "Treffen wir uns auf Zoom", sagt Gott, aber Hans macht eine verächtliche Handbewegung. "So'n Schnickschnack mach ich nicht mit." "Bitte", sagt Gott, "wo du doch das neue Handy hast." Aber Hans will nicht. Gott lässt nicht locker.
"Weiß nicht, wie das geht", murmelt Hans schließlich.
"Musste ich auch lernen", sagt Gott, "ist nicht schwer."
Da wird Hans hellhörig. "Du? Wenn einer nix lernen muss, dann doch wohl du!"
"Hans, wie kommst du denn auf sowas." Und dann sagt Gott einen seiner Sätze: "Ich werde sein, der ich sein werde." Und weil Hans guckt, wie er guckt, wenn er mit was nichts anfangen kann, sagt Gott es nochmal in anders: "Ich höre nie auf zu Werden."
Das verschlägt Hans fast die Sprache. Weil es so anstrengend klingt: "Wieso das denn?"
"Ich werde, damit du wirst", sagt Gott.
Hans lächelt schief, er hat keine Ahnung, was Gott damit meint. Aber es klingt gut.
Berühr mich (nicht). Noli me tangere

Er ist tot. Mausetot. Auch, wenn sie es nicht wahrhaben will. Sie haben ihn in ein Grab gelegt, hierzulande sind das Höhlen. Sie werden mit einem Stein verschlossen. Eher einem Fels. Daran gibt es nichts zu rütteln. Seit drei Tagen liegt er da drin, eine ganze Ewigkeit also. Als Magdalena den Friedhof betritt, ist es noch früh. Der Horizont ist schwarz, nur ein paar Vögel versuchen, die Nacht zu verscheuchen. Auf dem Gras liegt Tau. Sie kann nicht sagen, was sie hier will. Warum sie gekommen ist. Hauptsache nicht länger herumsitzen und warten. Warten, dass ein Wunder geschieht. Sein Grab liegt ganz hinten, zwischen den Olivenbäumen. Ein schöner Ort zu Lebzeiten. Dort hätte es ihm gefallen, denkt sie und spürt den Stich, weil nichts mehr so ist, wie es normal war. Sie können sich nicht mehr verabreden, Brot und Wein auspacken, reden und lachen. Das Lachen fehlt ihr am meisten.
Ihre Füße streifen die feuchten Gräser. Jetzt müsste sie gleich da sein. Verunsichert bleibt sie stehen. Hat sie sich verlaufen? Nein. Da ist der Olivenhain, dort ist die Höhle. Nur der Stein ist weg. Dieser Fels. Jemand hat ihn zur Seite gewälzt, als hätte ein Riese seine Hände im Spiel gehabt. Die Höhle liegt offen und schwarz vor ihr. Sie schrickt zurück und zögert, aber dann setzt sie einen Schritt ins Dunkle. Dann noch einen. Ihre Augen müssen sich erst an die Schwärze gewöhnen, doch es bleibt dabei: Sie sieht nichts. Das Grab ist leer.
Magdalena stürzt hinaus, kopflos, wo haben sie ihn hingebracht? Tiefstehende Sonnenstrahlen blenden sie. Die Vögel halten den Atem an. Da hört sie ihren Namen. „Magdalena!“ Sie wendet sich um, eine halbe Drehung – und sieht ihn. Seine Augen leuchten, ihr Herz macht einen Sprung. Schon will sie zu ihm laufen, will ihn in die Arme schließen, doch er hält sie zurück: „Berühr mich nicht.“
Ich schrecke hoch. Im Zimmer ist es dunkel, meine Hand tastet nach dem Wecker. Zehn nach vier. Kein Olivenhain, sondern meine Zwei-Zimmer-Wohnung im dritten Stock. Es ist Woche vier der Pandemie, ich spüre schlafwarme Haut und denke: Ich will berührt werden. Nicht immer und nicht überall, ich bin nicht der Küsschen-hier, Küsschen-da-Typ. Aber Freundinnen würde ich gern umarmen. Dem Berater bei der Bank die Hand geben. Mit Freunden die Köpfe zusammenstecken, Schulter an Schulter sitzen. Und nun träume ich ausgerechnet in der Osternacht diesen Traum, und nicht mal der hat ein Happy End. Dabei habe ich eigentlich nicht viel übrig für die Hollywoodfilme mit ihren Geigen am Schluss, aber jetzt könnte ich ein Happy End wirklich brauchen.
Einmeterdreiundachtzig entfernt, am Fußende des Bettes sitzt Jesus und nickt: „Ich auch...“
Weiterlesen oder Weiterhören:
Ostermorgen

Steht einer im Licht
des allerersten Tages
zum Aufbruch bereit
Sagt: Halt nichts fest
und in meinen Händen
keimt eine Erinnerung
an Morgen
So frei

Einmal ging Jesus in die Wüste,
er musste etwas herausfinden,
er aß nicht, er sprach nicht, er schaute kein Netflix,
er twitterte nichts, vielleicht betete er.
Nach 40 Tagen war er hungrig
Und mit dem Hunger kam die Versuchung
Sie trug ein Regenbogenshirt
und ihre Stimme klang nach Mars Schokoriegel im Doppelpack:
„Wenn Gott wirklich mit dir ist, nimm dir was du brauchst
und lass diese Steine Brot werden.“
Aber Jesus schüttelte den Kopf:
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
sondern von Worten und Träumen, die aus Gottes Mund kommen.“
Die Versuchung gab nicht auf,
sondern nahm ihn ins Allerheiligste
und stellte ihn heraus aufs Höchste
und legte einen Glitter & Sparkle-Filter um ihn
dass er leuchtete, hell wie das Universum
und rief:
„Du bist der Größte! Zeig, was du kannst! Spring!
Steht nicht geschrieben, dass Engel dich auf Händen tragen?“
Aber Jesus stieß die Versuchung weg:
„Es steht auch geschrieben:
Du sollst Gott nicht auf die Probe stellen.“
Die Versuchung ließ noch immer nicht locker,
sie bot ihm alle Königreiche und das weltweite Netz,
und schenkte ihm 10 Tausend neue Follower auf Insta,
die berät wären, ihn anzubeten,
und ließ Likes und Konfetti regnen:
„Das alles“, rief sie, „gehört dir,
wenn du mich anbetest!“
Aber Jesus stemmte sich dagegen:
„Niemals! Ich will niemanden anbeten, außer Gott.
Ich bin so frei.“
Da gab sich die Versuchung geschlagen
und es kamen Engel und brachten Gin Tonic und Falafel
und ein frisches Hemd in Himmelblau.
nach Matthäus 4, aus der Wohnzimmerkirche auf Instagram am 26. März
Liebesglut

Der Papst sagt, er könne zwei, die einander lieben, nicht segnen, weil Gott ihren Sex nicht mag. Gott ist das unangenehm. Man könnte glatt den Eindruck bekommen, er drücke sich an fremden Schlafzimmerfenstern herum. Dabei drückt er sich höchstens in fremden Herzen herum, und die sind nicht mal fremd, sondern Zweitwohnsitze. Besonders da, wo die Liebe wohnt, ist er gern. Gott wärmt sich auf, bevor er weiterzieht zu den erloschenen Herzen. Dort bläst er in die Liebesglut, dass sie auflodern möge. Auch beim Papst schaut er immer wieder mal vorbei.
Sonntagssegen

Beim Aufwachen zu lesen
Bitte gönn dir was
das Konzert der Meisen
Milchschaumminuten
eine verlorene Uhr
Plüschgedanken
Der Himmel ist
ein Gemischtwarenladen
Er hat jetzt geöffnet
für dich
Vergiss nicht, was du willst

Lydia hat vier Sachen in ihrem Leben gelernt:
1. Wenn du Erfolg haben willst, brauchst du Kraft wie fünf Männer.
2. Du hast Kraft wie fünf Männer.
3. Vergiss die Kompromisse.
4. Vergiss nicht, was du willst.
Lydia will zusammen essen, Brot backen, Apfelbäume pflanzen und nach Gott Ausschau halten – denn zu vielen sieht man mehr. „Ich will beten und wenn es sein muss auch herumstottern, ich will zusammen singen, Lagerfeuer machen, das Sonderbare nicht scheuen, ich will fasten, Buttercremetorte backen und Buttercremetorte teilen, ich will feiern, Geschichten erzählen, Seelen trösten, Ja sagen, ich will helfen, handauflegen, zuhören, die Tür will ich weit öffnen, ich will träumen, ich will taufen, ich will den Himmel an die Wand malen. Ich will lieben, zusammengefasst.“
Da kann keiner nein sagen, und so wird Lydia die allererste Christin in ganz Europa, und die erste Gemeindevorsteherin, und die erste Bischöfin ist sie auch. Denn andere gibt es ja noch nicht.
Kleine Erinnerung zum Weltfrauentag aus: Eva und der Zitronenfalter. Frauengeschichten aus der Bibel
PS: Ich schreibe bis Ostern übrigens wieder täglich auf chrimonshop.de
Sonntagsstimmung

Sonntags bin ich der Mensch, der ich gern wäre. Die Zeit und ich sind uns ausnahmsweise einig: Es gibt nichts zu müssen. Allen Aufgaben gebe ich frei. Der Himmel steht offen, ich erhasche einen Blick, wie es sein könnte. Gott ist erleichtert, weil ich endlich gelöst bin. Eine Blume sagt: Riech mal. Ich mache ihr die Freude.
aus: Luft nach oben. Der Sonntagskalender
Alles offen
Jesus und Maria Magdalena

Sie ist unabhängig. Eben wie man das landläufig so meint: Unverheiratet, mit einem Konto ausgestattet, das sie selber füllt. Eine Bohrmaschine hat sie auch (nutzt sie aber ungern. Wegen des Lärms. Und so viele Löcher braucht man gar nicht im Leben).
Er liebt sie. Mehr als die anderen. Aber ein Paar sind sie nicht.
Sie haben nie zusammen geschlafen. Obwohl es Momente gab, in denen es folgerichtig hätte sein können. Als sie am See saßen und die anderen längst gegangen waren. Sie redeten, während der Mond seine Runde drehte, bis er hinter den Kiefern verschwand. Ich liebe es, sagte sie, wie du meine Geister vertreibst, durch die Nacht mit mir gehst.
Im ersten Licht des Morgens sind sie geschwommen, vielleicht waren sie nackt, sie hat es vergessen. Später saßen sie zusammen in einem Boot, Schulter an Schulter. Es war eng und nicht unangenehm. Ich liebe es, sagte er, dass du mich berührst.
Er mag ihre Nähe, die immer etwas Waches hat. Sie lässt sich nicht fallen. Er hat nie das Gefühl, der Stärkere sein zu müssen. Sie lehnen aneinander, mit den Füßen auf der Erde. Das Boot schaukelte, sie genossen die Wärme ihrer nackten Haut, Bein und Arm. Sie genossen einander, ohne etwas zu wollen. Falls sie es doch taten, behielten sie es für sich, um das andere nicht zu stören, das leicht war und ihnen Flügel gab. Sie lernten, dass man nicht alles mitnehmen muss, was sich anbietet. Manchmal findet sie ihn schön. Seine Augen würde sie unter allen Augen erkennen. Auch seinen Körper. Er ist glatt, wie Marmor. Aber das sagt sie ihm nicht. Stattdessen: Deine Füße liebe ich. Deinen Kopf liebe ich auch. Er mag ihre Schultern. Sie sind muskulöser, als man zunächst denkt. Sie ist keine Sportlerin, sie gehört nicht zu den Frauen, die diszipliniert und geplant vorgehen. Aber sie bewegt sich gern und er genießt es, ihr dabei zuzusehen. Ich liebe es, sagt sie, wie du mich ansiehst. Nie habe ich das Gefühl, ich müsste mich verstecken.
Ich liebe es, sagt er, wie du einen Raum betrittst und die Blicke nicht wägst. Wie du dein Ding machst ohne Furcht.
Ihr Lachen macht sie zu Verschworenen. Wenn sie reden, dann reden sie nicht nur mit dem Kopf, sondern mit allem. Manchmal räkelt er sich wie eine große, schwere Raubkatze, wenn er einen Gedanken verfolgt. Sie fürchtet nichts an ihm. Obwohl er scharf sein kann, sogar verletzend. Bei ihr ist er es nicht. Sie weiß nicht, warum. Dabei kann sie selber auch scharf sein. Und schroff. Er sieht es ihr nach. Sie brauchen nicht miteinander zu kämpfen. Es gibt nicht zu behaupten und nichts zu gewinnen. Sie kennen einander zu gut.
Ich liebe es, sagt sie, dass du mich sein lässt, wie ich bin. Das verwandelt mich.
Es heißt, dass sie viele Männer hatte. Viel ist eine schwammige Zahl. Sie liebt Worte mehr als Zahlen. Aber gegen Sex hat sie nichts einzuwenden. So ein Satz kann gegen sie verwendet werden. Es heißt, dass sie versucht hat, ihn zu verführen. Er aber nicht wollte. Er konnte ihr widerstehen. Ihr, der Versuchung. Obwohl es andererseits auch nicht schlimm gewesen wäre, wenn er nicht widerstanden hätte: Sex macht Männern zu echten Männern und Frauen zu fragwürdigen Frauen. Für alleinstehende Frauen wie sie ist das ein Dilemma: Zu viel Sex ist schlecht, kein Sex aber auch. Eine Frau ohne Mann, ohne Kinder muss unglücklich sein. Wenn sie nicht unglücklich ist, dann stimmt etwas nicht mit ihr.Sie weiß, dass die Leute so denken. Er weiß es auch. Aber es spielt keine Rolle. Ich liebe deine heilige Furchtlosigkeit, sagt sie. Dass du dich nicht sorgst, was die Leute reden.
Manchmal sind ihre Worte wie Küsse. Sie schmecken salzig und süß. Wie Honig-Erdnüsse, denkt sie. Er denkt an Krebsfleisch. Sie essen oft zusammen. Ungeplant, Zufallsessen auf eine beiläufige, verschwenderische Art. Er brät ein Ei und sie öffnet eine Flasche Wein. Dabei reden sie weiter, kauen die Worten oder lassen sie auf der Zunge zergehen. Ich liebe es, sagt er, dass du eine Verschwenderin bist. Du rechnest nicht. Du wärst so eine schlechte Buchhalterin. Selber, denkt sie und lächelt in sich hinein.
Sie zeigen einander viel. Er lernt ihre Dämonen kennen und hält ihnen stand. Zum ersten Mal hat sie das Gefühl, sie nicht verteidigen zu müssen. Er würde nichts gegen sie verwenden. Dafür bleiben sie sich fern genug, sie müssen einander nichts heimzahlen. Auch sie ahnt etwas von seinem Schmerz. Obwohl er ihn nie zur Schau stellt. Auch von seiner Wut. Wie ein Sommergewitter bricht sie manchmal herein, unerwartet und heftig. Aber sie fürchtet sich nicht vor Gewittern.
Ich liebe es, sagt er, dass du mich nicht festnagelst.
Ich liebe es, sagt sie, dass du dich mir zeigst.
Ich liebe dich, sagen sie und lassen alles offen.
aus: Kirschen essen. Liebesgeschichten aus der Bibel. Edition chrismon
Lichtmess

Um acht ist es hell. Ich feiere das Licht und die Fresien auf der Fensterbank. Im Erwachen gibt es einen virusfreien Raum.
Meine Träume haben mittlerweile Handtaschenformat,
ich trage sie überall mit hin. Der Himmel ist noch unentschlossen, aber ich bin bereit.
Hellsehen

Wir sind da, Gott
auf dem Sofa,
in Flauschpantoffeln oder Lackschuhen
Wir haben die Perlen für dich angelegt
das Haar gescheitelt
das Hemd geknöpft
du siehst uns
Unsere Blicke gehen ins Schwarze
und über das Schwarze hinaus
Unsere Blicke kreuzen sich in einem virtuellen Raum
Du bist längst dort
Du hörst
wie unsere Herzen schlagen
du hörst die Nachbarn nebenan
und die Kinder, die nicht müde sind
und das Schweigen in den Konzertsälen hörst du auch.
Ich zeig euch was, sagst du.
Ich zeig euch, wie man hellsieht.
Amen
Gestern haben wir zum ersten Mal Wohnzimmerkirche auf Instagram gefeiert. Ein Prost auf Käsebrot, große Schwestern, Ausbruchsmomente, weiße Kleider, königlich sein und das Sekundenglück, das bereit liegt, wenn wir es sind. @wohnzimmerkirche
Januarmorgen

Noch ein grauer Januarmorgen. Schneereste auf dem Dach. Ich hab die Kerze im Fenster angezündet. Darauf ging gegenüber der Stern an. Vor ein paar Tagen hat mir die Frau mit dem Baby zugewinkt. Leben wie im Setzkasten. Ich mag das. Gott wohnt wahrscheinlich in der Wohnung mit der Amaryllis. Es ist nie jemand zu sehen, aber viel Papierkram auf dem Tisch. Über der Amaryllis hängt ein Herz. Es ist ein bisschen kitschig. Aber auch schrebbelig, ein Geschenk, das hängengeblieben ist. Irgendwann werde wir gleichzeitig aus dem Fenster sehen.
Barmherzigkeit

Ich bin Bonbonzerbeißerin. Ich weiß, das ist eine schlechte Angewohnheit, meine Zahnärztin liest hoffentlich nicht zu. Was ich noch bin: Große Schwester. Steuerzahlerin. Überzeugte Bahnfahrerin. Hoffnungsvolle Optimistin. Ich habe viele Facetten. Wie jeder Mensch. Ich finde es eine erleichternde Vorstellung, dass es bei allen Menschen etwas geben könnte, das uns verbindet. Man muss nur lang genug suchen. So würde ich mit Herrn Trump politisch wahrscheinlich nicht einig werden. Aber vielleicht teilen wir eine Vorliebe für Minzschokolade.
Leider geht es im Leben nicht nur um Süßigkeiten. Rassistische oder andere verachtende Haltungen möchte ich nicht kleinreden. Dennoch bleibt eine Gemeinsamkeit: Wir sind Menschen. Dieser kleinste gemeinsame Nenner besteht, er bleibt sogar dann bestehen, wenn Menschen unmenschlich handeln. Sie bleiben Menschen, weil Gott sie als solche erschaffen hat. Der erste Tod in der Bibel ist ein Mord. Kain erschlägt seinen Bruder Abel und darf trotzdem weiterleben. Gott verurteilt sein Tun, aber schützt ihn als Mensch. Ein altes Wort dafür ist Barmherzigkeit. Es ist staubig geworden, dabei ist es ein schönes Wort. Es wärmt und verwandelt. Wer mutig ist, bläst den Staub weg und lässt es wirken. Nimmt sich ein Herz für die Herzlosen und die Feindseligen. Für einen allein ist das vielleicht zuviel. Aber zusammen könnte es uns gelingen, darauf zu bestehen, dass Menschlichkeit siegt.
















